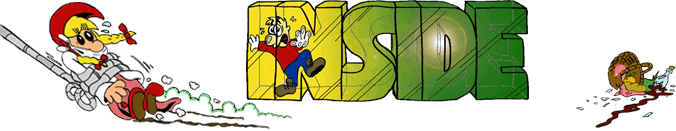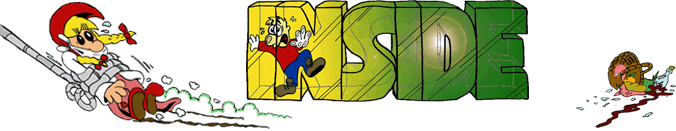Der Titel aus dem Französischen ist, wie Bernhard in genutzt hat " Der Weg nach Frankreich "
Im Niederländischen " 1792 Op weg naar Frankrijk " / Auf dem Weg nach Frankreich. Da ich dieses Buch für meine Übertragung genutzt habe, habe ich auch diesen Titel entsprechend übernommen.
Im Tschechischen wäre der Titel " Cesta do Francie " / " Reise nach Frankreich "