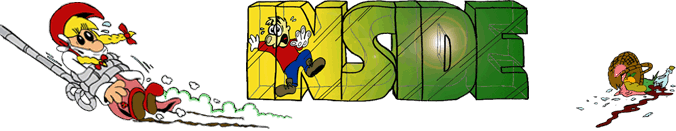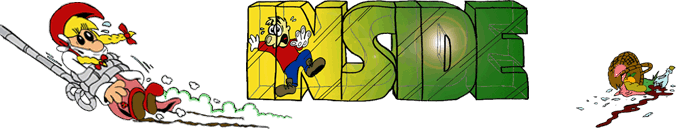Bedenkt man, dass der Protagonist
des Romans „In 80 Tagen um die Welt“ (1873) an keiner
Bürgerkriegsauseinandersetzung teilnimmt – außer man wertet den Angriff durch
amerikanische Ureinwohner auf Foggs Zug als solchen - überrascht es doch, dass
er in Film und Fernsehen überhaupt Partei ergreift und dann sogar noch einerseits
für den Süden als Bösewicht und andererseits als Held für den Norden. Zwischen
diesen beiden Interpretationen der Figur im Medium Film liegen ca. 90 Jahre. Vor
der Analyse beider Filmadaptionen stellt sich die Frage, wie eine solche
Bandbreite der Interpretation überhaupt möglich ist, da deren beide Pole die
Extreme der stereotypen Charakterisierung einer fiktiven Figur darstellen. Die
Antwort liegt auf der Hand: Der Mangel an Charakterisierung in Vernes Roman
bietet genug Leerstellen, um mannigfaltige Interpretationen dieser Figur
zuzulassen.
Bezüglich seiner Funktion im
Roman, stellt man schnell fest, dass Fogg zwar die Handlung motiviert und als
MacGuffin – wie Hitchcock einen für sich genommen bedeutungslosen, aber die
Handlung auslösenden Gegenstand oder Person bezeichnet – funktioniert, der
Handelnde ist jedoch Passepartout.
Setzt man dies grundsätzlich voraus,
kann man nach Quellen in Vernes Werk suchen, in dessen Handlung Foggs neu
konstruierte Persönlichkeit eingefügt worden ist. Den amerikanischen Bürgerkrieg
als Hintergrundhandlung – mehr ist es nicht – könnte vor allem der 1887
erschienene Roman „Nord gegen Süd“ geliefert haben. Darüber hinaus kommt die
Erzählung „Die Blockadebrecher“ (1871) natürlich ebenso in Betracht.
Da beide untersuchten Filmbeispiele
einen Konflikt zwischen dem Helden und seiner Nemesis zum Kern haben, weist
„Nord gegen Süd“ eine Handlungsstruktur auf, die einen besseren Rahmen für
einen solchen Konflikt zu bieten scheint. James Burbank steht in diesem Roman
als politisch korrekter Held der Sache der Nordstaaten nahe und im Zentrum der
Handlung. Sein Gegenspieler ist der Sklavenjäger Texar. Dieser Antagonismus
zwischen Held und Sklavenjäger ist in den „Voyages Extraordinaires“ seit „Fünf
Wochen im Ballon“ (1863) grundgelegt. Weiterhin gibt es als Handlungselemente
die Entführung einer dem Helden nahe stehenden Person (seiner Tochter) und
deren Befreiung aus einem für den Helden nur schwer zugänglichen Versteck.
Im Folgenden wird untersucht, ob
diese Elemente und Figurenkonstellationen in den Filmbeispielen nachgewiesen
werden können und so ein intertextueller Bezug in den Drehbuchfassungen
zwischen "Nord gegen Süd" und Phileas Fogg aus "Die Reise um die Erde in 80 Tagen"
(1873) hergestellt werden kann. Zunächst wird die ältere der beiden filmischen
Umsetzungen hinsichtlich der Untersuchungsmerkmale vorgestellt.
Schon die Auswahl einer
literarischen Parodie auf das ursprüngliche Romanuniversum aus dem die Figur
des Phileas Fogg stammt, als Grundlage für die Filmadaption zu nehmen, zeigt
die Distanz, eine natürlich auch gewollte ironische Distanz zur Figur, die
durch die Übertragung in das Medium Film noch verstärkt wird. Schließlich wird
der Rezipient durch die Wahrnehmung zweidimensionaler, bewegter Bilder noch
stärker in die Rolle des passiven Beobachters gedrängt, der er ja schon bei der
Romanlektüre ist. Wünsche, Absichten und Neigungen der Figuren werden lediglich
durch Mimik, Gestik, Zwischentitel und Musik vermittelt. Das gesprochene Wort
war in der Kinoversion von Albert Robidas 1879 erschienenen "Voyages très extraordinaires de Saturnin Farandoul (dans les 5 ou 6
parties du monde et dans tous les pays connus et même inconnus de M. Jules Verne" noch nicht Bestandteil des Mediums
Film.
Die italienische Stummfilmumsetzung
des Romans von 1913 als frühes Kinoserial ist leider nur noch als ca.
77-minütiges Fragment erhalten. Dieses wurde dankenswerterweise von Serge
Bromberg für Lobster Film restauriert und von dem deutsch-französischen
Gemeinschaftssender Arte auch der deutschen Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt.
Der Teil des Fragments, der sich
mit der Figur des Phileas Fogg beschäftigt, trägt sowohl dessen Namen im Titel
als auch einen deutlichen Hinweis darauf, welcher Travestie die Figur
unterzogen worden ist: „Der Verrat des Phileas Fogg“. Im Original - „Il
tradimento di Fileas-Fogg“ - könnten Puristen jetzt einwenden, zeige die
abweichende Schreibung, dass es keine eindeutige Zuordnung zum ursprünglichen
Fogg gebe. Dem kann man jedoch getrost auf der Grundlage des Titels der
Romanvorlage widersprechen, die sich ja explizit auf die Welt Vernes bezieht.
Gleiches gilt für den Reihentitel – wenn man sich die Urform des Films als
Serial ins Gedächtnis ruft.
„Die außergewöhnlichen Abenteuer
des Saturnino Farandola“ enthält neben dem Fokus auf den Namen eines Helden,
wie von Verne oft verwendet, sowohl das Attribut "außergewöhnlich" wie
Vernes Buchreihe als auch das Substantiv
"Abenteuer", das sich immer wieder in Verne-Titeln findet. Der
Plural, in dem "Abenteuer" steht, spiegelt das Additive wider, d.h.
dass dieser Held in mehreren und auf unterschiedlichen Geschichten beruhenden
Abenteuern auftritt.
Entscheidend für den Nachweis von
intertextuellen Zusammenhängen ist sicherlich das Vorhandensein der oben
genannten Merkmale, die aus dem Plot des Romans "Nord gegen Süd"
extrahiert worden sind.
Der eigentliche Held in „Der
Verrat des Phileas Fogg“ ist Saturnino Farandola, der wie andere Helden des
Abenteuergenres von Tieren der Wildnis aufgezogen worden ist. Der holzschnittartig
gezeichnete Charakter der von Marcel Fabre gespielten Titelfigur verkörpert den
Typus des Abenteurers schlechthin, den des so genannten Swashbucklers, der
Abenteuer um ihrer selbst willen erlebt und dabei stets der Gefahr ins Gesicht
lacht.
Mehr oder weniger aus Langeweile
mischt sich dieser in einen inneramerikanischen Konflikt zwischen den Fantasiestaaten
Süd- und Nord-Milligan, in deren Streit um die Niagarafällen er geraten ist. Abweichend
von der Romanvorlage wird hier also kein historischer Konflikt als Handlungshintergrund
gewählt, sondern ein Operettenszenario, das regional in der Nähe des historischen
Konflikts zu verorten ist, da sich zumindest die Niagarafälle auf nordamerikanischem
Gebiet befinden.
Als Mysora, Saturninos Ehefrau,
in die Hände Phileas Foggs gerät, muss der Titelheld sie aus dessen schwer zu
erreichenden Versteck befreien. Dieses Versteck befindet sich interessanterweise
in der Luft, in einem Heißluftballon. Interessant ist das deshalb, weil auch
das zweite filmische Finale von Foggs Bürgerkriegserlebnisse 90 Jahre später
mit einem Luftkampf endet.
Der geschlagene Phileas Fogg, ein
Bilderbuchschurke mit dunklem Bart, stürzt zu Tode. Eine Charakterisierung der
Figur jenseits seiner Gier und des Umstands, dass er die Frau des Helden begehrt
("Der Pilot von der Donau" lässt grüßen), findet nicht statt, aber
was lässt sich im Gegenzug über den Charakter der Romanfigur groß sagen?
(wird fortgesetzt)
https://3c.web.de/mail-1.79.211.…selection=pid_1
https://3c.web.de/mail-1.79.211.…selection=pid_1