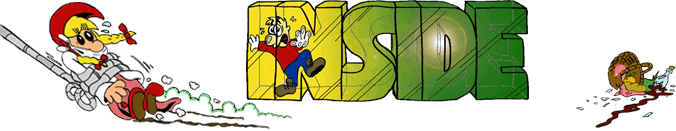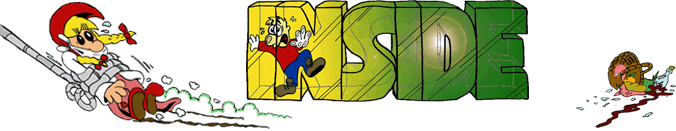Huch, da muß ich mich wohl schämen ![]() - ich hab mal nen ganz seltsamen Löffel mitgehen lassen
- ich hab mal nen ganz seltsamen Löffel mitgehen lassen ![]() - eigentlich weiß ich gar nicht, wofür der gut ist - der ist fast völlig flach, vielleicht war's eher sowas wie ein Buttermesser
- eigentlich weiß ich gar nicht, wofür der gut ist - der ist fast völlig flach, vielleicht war's eher sowas wie ein Buttermesser ![]() . Ansonsten muß ich sagen, hat mich im Hotel noch nichts so wirklich reizen können
. Ansonsten muß ich sagen, hat mich im Hotel noch nichts so wirklich reizen können ![]() - aber in einer prähistorischen Höhle in Frankreich hab ich mal zugeschlagen (ich war 15) - da guckte mich aus einer roten Wand etwas Weißes an und fragte mich: Was bin ich?. Das hab ich rausgepuhlt und hinterher festgestellt, daß es ein Knochen war
- aber in einer prähistorischen Höhle in Frankreich hab ich mal zugeschlagen (ich war 15) - da guckte mich aus einer roten Wand etwas Weißes an und fragte mich: Was bin ich?. Das hab ich rausgepuhlt und hinterher festgestellt, daß es ein Knochen war ![]() . Den habe ich heute noch
. Den habe ich heute noch ![]() . Und in Mexiko City in der Ruinenstätte Teotihuacan habe ich Obsidian-Messerchen vom Boden aufgesammelt und mitgenommen. Die lagen da überall rum und da dachte ich - ähnlich wie der gute Herr Wickert - wenn die hier auf dem Weg rumfliegen, kann ich sie ruhig einsammeln. Aber die sind bestimmt uralt - so aus dem 14. Jahrhundert ca. Das war im zarten Alter von 16. Später habe ich mich dann allerdings anständig entwickelt
. Und in Mexiko City in der Ruinenstätte Teotihuacan habe ich Obsidian-Messerchen vom Boden aufgesammelt und mitgenommen. Die lagen da überall rum und da dachte ich - ähnlich wie der gute Herr Wickert - wenn die hier auf dem Weg rumfliegen, kann ich sie ruhig einsammeln. Aber die sind bestimmt uralt - so aus dem 14. Jahrhundert ca. Das war im zarten Alter von 16. Später habe ich mich dann allerdings anständig entwickelt ![]() . Als ich mit knapp über 20 mit meinem damaligen Freund in Paris war, hatte der sich in den Kopf gesetzt, mir in einem Kaufhaus einen Rouge-Pinsel zu klauen
. Als ich mit knapp über 20 mit meinem damaligen Freund in Paris war, hatte der sich in den Kopf gesetzt, mir in einem Kaufhaus einen Rouge-Pinsel zu klauen ![]() - ich hab zwar versucht, es ihm auszureden, es ist mir allerdings nicht gelungen
- ich hab zwar versucht, es ihm auszureden, es ist mir allerdings nicht gelungen ![]() .
.
Beiträge von Clavelina
-
-
Und jetzt die Preisfrage - Wer von Euch hat denn noch NICHT...?

-
Ulrich Wickert Ming-Ziegel
Mein liebstes geklautes Souvenir – das ist ein alter chinesischer Dachziegel. Einst bedeckte er die Ming-Gräber nahe bei Peking, nun schmückt er mein Regal. Und das kam so: Ich habe neben den Gräbern gepicknickt – und dann lag er da. Er war vom Dach gefallen, direkt vor meine Picknickdecke. Wäre er oben auf dem Grab gewesen und nicht dort im Staub und Gras, ich hätte ihn nicht eingesteckt. Immerhin ist es ein sehr alter Ziegel, die Ming-Zeit ging 1644 zu Ende. So aber habe ich ihn in Wäsche gewickelt und eingepackt. 1979 war es noch nicht üblich, nach China zu reisen, ich dachte: Wer weiß, ob du je wieder hier Urlaub machst? Der Ziegel ist gelb lasiert und mit einem Drachen verziert – zwei Handbreit Altchina in meiner Wohnzimmerecke.
Ulrich Wickert, 61, ist Moderator der »Tagesthemen«. Er gab »Das Buch der Tugenden« heraus und schrieb den Kriminalroman »Der Richter aus Paris«
Roger Willemsen Kleiderbügel
Nö, Hotels beklaue ich nicht, die nicht. Wenn ich an einen Hotelzimmerschrank trete, und da hängen die trostlosen Plastikbügel in Metall-Ösen, dann sehe ich eine Nation von Dieben vor mir, die sogar dieses Gerümpel noch abschleppen würden. Sofort fühle ich mich auch selbst als Dieb und werde moralisch. Ein einziges Mal habe ich einen solchen Bügel wirklich mitgenommen, aber da war ich bezecht, zog den Mantel mit Bügel an und war damit stundenlang in der Nacht unterwegs. Ein Taxifahrer hat mich instand gesetzt und den Bügel einfach in die Nacht geschleudert. Das macht man auch nicht.
Roger Willemsen, 49, ist Journalist, Moderator und Buchautor (u. a. »Deutschlandreise«). Auf 3sat moderiert er den »Literaturclub«
Matthias Politycki Kerzenständer
Wir waren in Dougga, einer antiken Römerstadt im tunesischen Niemandsland – zwei, drei Touristen, die sich in den Ruinenstraßen zerstreuten, meine Freundin und ich. Am Ende der Stadt, viele Trampelpfade entfernt, entdeckten wir die ehemalige Zisterne – ein höhlenhaftes Gewölbe, vollkommen leer. Im Innern sah ich ein Gittertürchen, davor Hühnerfedern und eine brennende Kerze. Eine Kultstätte? Ein Schlachtplatz? Ich konnte nicht widerstehen, ergriff die Kerze, öffnete die Tür – und kroch in einen Gang, der sich hüfthoch durch den Felsen schlängelte. Um nach etwa vierzig Metern in einer Ansammlung aus Decken und Krimskrams zu enden: ein Versteck! Ich griff mir das einzige, das mir souvenirfähig erschien – einen Kerzenständer aus unbemaltem Ton. Zurück am Ausgang, sah ich zweierlei: meine Freundin, die aufgeregt Zeichen machte. Und fünf Männer in wallenden Gewändern, die sich zielstrebig näherten. Schnell stellten wir die Kerze zurück, steckten den Ständer in eine Tasche und schlenderten an ihnen vorbei, so harmlos touristisch wie möglich. Seit jenem Sommer 1980 hat der Kerzenständer einen Ehrenplatz auf meinem Regal. Der Moment war ja auch unvergesslich: Du steckst in einer Zisterne, es gibt nur einen Ausgang, und vor dir stehen fünf tunesische Hühnermörder? Schwerverbrecher?, die du gerade beklaut hast.
Matthias Politycki, 49, ist Schriftsteller (»Weiberroman«, »Ratschlag zum Verzehr der Seidenraupe«)
Fritzi Haberlandt »Bitte nicht stören«-Schild
Vor sechs Jahren war ich in einem Hotel in Slowenien. Da hingen großartige »Bitte nicht stören«-Plastikschilder an den Türen – in knalligem Siebziger-Jahre-Design. Auf der roten Seite sieht man einen Mann, der den Zeigefinger vor den Mund hält. Die grüne Seite zeigt eine junge Frau, die sich über einen Staubsauger beugt. Er ist ein seriöser Herr mit Krawatte und sie so ein sexy Mädel mit Minirock und Bobfrisur. Eigentlich hatte ich das Schild ja für die Freundin geklaut, mit der ich das Hotelzimmer geteilt hatte. Sie fand es toll, ich wollte es ihr schenken. Dann sah ich es zu Hause im Koffer liegen und konnte mich nicht davon trennen. Ein etwas schlechtes Gewissen hatte ich da schon – der Freundin gegenüber, nicht dem Hotel. Jetzt hängt das Schild in Berlin an meiner Zimmertür. Manchmal, wenn ich gestresst bin, drehe ich es um. Der Krawattenmann wirkt – auch bei Freunden.
Fritzi Haberlandt, 29, ist vielfach preisgekrönte Schauspielerin am Hamburger Thalia Theater. Im Kino war sie zuletzt in »Erbsen auf halb 6« zu sehen
Kai Hollmann Aschenbecher
Früher habe ich Aschenbecher aus aller Welt gesammelt. Wenn Freunde kamen, habe ich jedes Mal einen anderen Aschenbecher auf den Tisch gestellt und zum Beispiel gesagt: Den hier habe ich aus dem Four Seasons in Bali. Ich fand das schick. Ich habe auch Aschenbecher aus den USA, Afrika, England, Frankreich und Italien. Zusammen etwa 50 Stück. Den schönsten habe ich in Südafrika mitgehen lassen. Wir schliefen in einer Safari-Lodge, mitten im Nationalpark, wo nachts die Löwen brüllen und in der Ferne Elefanten trampeln. Den Ascher habe ich eingesteckt, weil er so sorgsam geschnitzt war. Erst später sah ich: Der ist ja aus Elfenbein. Da hatte ich ein grausig schlechtes Gewissen. Die meisten meiner geklauten Ascher aber sind nicht wertvoll. Sie sehen bloß hübsch aus. Zweimal habe ich den Hotels sogar nachträglich einen Obolus geschickt – die Bediensteten hatten mich so seltsam angeschaut. Seit meiner Ausbildung kenne ich nun die Gegenseite. In meinen Hotels stehen nur ganz schlichte Aschenbecher ohne Logo. Als Sammler weiß ich: Die packt garantiert niemand ein.
Kai Hollmann, 47, wurde 2003 zum Hotelier des Jahres gewählt. Er ist Direktor und Betreiber der Design-Hotels Gastwerk und 25hrs in Hamburg
Bastian Pastewka Badeschlappen
Ich galt in meiner Band Twilight, in der ich zu New-Age-Zeiten als Keyboarder spielte, schon in meinen frühen Zwanzigern als Hardcore-Spießer, weil ich den Hotelbademantel, den ein Kollege eingesteckt hatte, an die Rezeption zurückbrachte. Mit den Worten, ich hätte ihn versehentlich mitgenommen. Kavaliersdelikt Hotelklau? Von wegen. Ich finde das nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch menschlich unterirdisch. Ein einziges Mal wurde ich weich, aber da war Stuttgart schuld. Die Stadt echauffierte mich derart, dass ich sie fluchtartig wieder verließ, und zwar auf diesen fiesen, labbrigen Hotel-Badeschlappen, die immer drei Nummern zu klein sind. Tags darauf wanderte das baumwollene Grauen direkt in den Müll.
Bastian Pastewka, 32, Komiker und Schauspieler, spielte zuletzt im Kinofilm »Der Wixxer« mit
Helga Hengge Gebetsfahnen
Ich habe auf dem Mount Everest die Götter beklaut. Auf den Wegen hinauf zum Gipfel hängen überall Gebetsfahnen. Wehen sie im Wind, dann tragen sie Gebete in den Himmel und schützen die Bergsteiger. So glauben es die Sherpas. Man darf die Fahnen also nicht entfernen. Doch mir schienen sie ein ideales Souvenir zu sein: Dort in der Höhe waren sie die einzigen Farboasen inmitten von Steinen und Eis. Es war mein größter Traum, den Everest zu bezwingen, drei Männer sind auf der Tour gestorben, ich habe überlebt. Ich wünschte mir so sehr ein Andenken! Also zog ich heimlich los und überredete unseren Küchenchef – der hatte auch eine andere Religion und ein großes Messer. Er hat mir 25 Gebetsfahnen abgeschnitten, die habe ich dann ganz unten in den Rucksack gesteckt. Keiner sollte sie entdecken, denn ein bisschen geschämt habe ich mich schon. Da lebt man zwei Monate mit Menschen einer anderen Kultur zusammen, und dann tut man etwas, das ist, als würde man in der Kirche eine Heiligenstatue klauen. Zu Hause habe ich die Fahnen auf den Balkon gehängt. Als Wiedergutmachung: Wenigstens wehen sie im Wind – vielleicht leiten sie jetzt Gebete in den Münchner Himmel.
Helga Hengge, 38, Profibergsteigerin, hat 1999 als erste deutsche Frau den Mount Everest bezwungen
Renate Künast Handtuch
Es war ein kleines Handtuch in einem Hotel, kurz nach der Wende in Sachsen-Anhalt. Ich hatte Ferien, wollte die Republik erkunden, nun schlief ich im Plattenbau und sah dieses Handtuch. Robuste, gestreifte Baumwolle, mit einer Webkante am Rand. An einer Ecke war das Handtuch seltsam dick. Das habe ich mir genauer angeschaut und vorsichtig die Naht aufgetrennt. Zum Vorschein kamen drei Buchstaben: MfS. Die Hotelbetreiber hatten nur schnell die Ecke umgenäht – und das Ministerium-für-Staatssicherheit-Handtuch wieder den Gästen hingehängt. Ich habe es dann eingesteckt, auch wenn ich das sonst nie tue. Ein Stasi-Handtuch, das ist doch ein unwiederbringliches Relikt. Einen materiellen Verlust hat das Hotel nicht erlitten. Zu Hause stellte ich nämlich fest, dass ich meinen Fön liegen gelassen hatte.
Renate Künast, 48, ist Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (Grüne)
Aufgezeichnet von: Cosima Schmitt und Andrea Thilo (Bastian Pastewka)
(c) DIE ZEIT 02.09.2004 Nr.37
-
Bei diesem Artikel habe ich mich echt amüsiert

Hotelsouvenire
In deutschen Hotels wird alles geklaut, was nicht niet- und nagelfest ist. Manch ein Gast lässt sich beim Abtransport vom Pagen unter die Arme greifenVon Michael Allmaier
Man merkt es kaum. Man soll es auch nicht merken. Der Fön ist doch sicher nur an die Wand montiert, damit ihn kein Lebensmüder mit in die Badewanne nimmt. Die Spezialschrauben im Bilderrahmen schützen vielleicht bloß das Bild vor dem Verrutschen. Doch spätestens bei den Kleiderbügeln ohne Haken gehen selbst dem treuherzigsten Hotelgast die Erklärungen aus, und er muss sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass die Hotelleitung ihn nicht nur als Nutznießer ihrer Sicherheitsvorkehrungen sieht.
Das Problem hat einen Namen. Er lautet »Schwund« und umfasst die Millionen Dinge, die alljährlich aus deutschen Hotels verschwinden – und zwar in den Koffern der Gäste. Doch bei einer Straftat, die ob ihrer Häufigkeit mehr noch als Volkssport denn als Kavaliersdelikt gilt, mögen selbst die Geschädigten von Diebstahl nicht reden.
Nach den Erfahrungen von Richy Okorie, Director of Services im Marriott an der Frankfurter Messe, nehmen fünf bis sieben Prozent seiner Gäste etwas aus ihrem Zimmer mit. Allein 30 bis 40 Bademäntel verschwinden jeden Monat. In den sieben Kettenhotels, die die Hotel-Management und Service-Gesellschaft HMG betreibt, geht es ähnlich hoch her. Der Geschäftsführer der HMG, Hartmut Schröder, zählt längst keine Bademäntel mehr, er zählt bloß die Kosten: »Hohe fünfstellige Beträge im Jahr.«
Die Hoteliers haben vor Jahren einmal Hitlisten der beliebtesten Souvenirs erstellt: Bademäntel standen da auf Platz drei hinter Handtüchern und Aschenbechern. Aber offenbar verschwindet früher oder später so ziemlich alles. Da werden Glühbirnen herausgeschraubt, Seifenspender abmontiert, Fernseher ausgeschlachtet, Türschilder heruntergerissen, Schuhputzautomaten hochgewuchtet und oft genug auch noch, neutral verpackt, vom nichtsahnenden Pagen zum Auto gebracht. »Es gibt nichts, was nicht interessant wäre«, sagt Schröder. Er beklagt aus jüngerer Zeit den Verlust eines Zigarettenautomaten und mehrerer Toilettenbrillen.
Was treibt brave Bürger, unterwegs Dinge zu klauen, die sie daheim wohl geschenkt nicht annähmen? Bernd Kielmann, Institutsleiter der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie, hat sich auf das Seelenleben von Reisenden spezialisiert. Er unterscheidet fünf Typen. Erstens den Trophäenjäger, der es auf alles abgesehen hat, was ein Hotel-Logo trägt, um daheim damit zu prahlen – sei es mit der exklusiven Herberge, die er sich gegönnt hat, sei es mit der eigenen Unverfrorenheit. Zweitens den Geizhals: Er sieht nicht ein, warum er bei einem Zimmerpreis von 120 Euro noch einmal 8 Euro für ein Fläschchen Cognac berappen soll. Ihm verwandt ist, drittens, der Spießer, der bloß nichts verkommen lassen will. So viele Batterien, die in kaum genutzten Fernbedienungen vergammeln; so viele Biergläser, die die Hotels doch sicher geschenkt kriegen. Wer wird die schon vermissen? Viertens: der Rebell, der sich in der Kunstwelt der Hotels an all das erinnert fühlt, was er am bürgerlichen Leben verabscheut, und handgreiflich protestiert. In diese Gruppe gehören jene Kindsköpfe, die die Minibarfläschchen leer trinken und mit Wasser wieder auffüllen. Fünftens schließlich der Sammler, der gerade im Urlaub Zeit für sein Hobby findet. Das beginnt bei harmlosen Vorlieben wie jener für »Bitte nicht stören!«-Schildchen, von denen ein Liebhaber aus Moers bereits einige tausend beisammen hat, kann aber auch zwanghafte Formen annehmen. Der Rechtsanwalt Rolf Treutler erinnert sich an einen solchen Fall: »Einmal wurde ich von einem Hotelier aus der Nachbarschaft gerufen, weil der einen Gast beim Einstecken eines Salzstreuers beobachtet hatte. ›Sie sind wohl Sammler‹, sagte ich zu ihm. Da rief der: ›Das ist gut!‹, haute mir auf die Schulter und holte mindestens zehn Streuer aus der Tasche.«
Treutler ist einer der Leute, an die Hotels sich wenden, wenn Gäste die Gastfreundschaft strapazieren. Aber bei Kleindiebstählen, meint er, ist juristisch nicht viel zu machen. Man erwischt die Handtuchmopser ja selten in flagranti. Das Hotel muss darum nachweisen, dass der vermisste Gegenstand beim Einzug des Gastes noch da war und dass niemand sonst als Dieb in Betracht kommt. Richy Okorie hat damit schlechte Erfahrungen gemacht: »Ein Gast hat uns mal das halbe Zimmer ausgeräumt und die Matratze verbrannt. Als wir seine Kreditkarte belastet haben, kam ein Brief von seinem Anwalt: Ob wir Zeugen hätten? Wir mussten das Geld zurückerstatten.«
Mancher Hotelier hat sich darum zähneknirschend aufs Bitten verlegt. Hartmut Schröder sagt: »Wenn wir einen Bademantel vermissen, schreiben wir dem Gast einen höflichen Brief, ob er über den Verbleib etwas weiß.« Und wenn er es nicht weiß? »Dann haben wir einen Bademantel weniger, und er hat einen mehr.« Selbst wenn mal ein Übeltäter beim Auschecken gestellt werden kann, hat er wenig zu befürchten. Man sieht in ihm auch weiter vor allem den zahlenden Kunden. »Und wer«, fragt Richy Okorie, »möchte schon einen VIP-Gast auf einen abmontierten Duschkopf ansprechen?«
Bleibt nur die Vorsorge. Dort allerdings wurde schon einiges ausprobiert:
1. Big Brother: Gegen Diebe von außen muss sich das Hotel ohnehin schützen. Warum nicht nebenbei auch dem Schwund wehren? Das Estrel in Berlin setzt auf kameraüberwachte Flure und elektronische Schlösser, die festhalten, wer wann welche Tür öffnet. Die Marriott-Kette schult Zimmermädchen, beim Saubermachen diskret den Bestand zu kontrollieren. Die Hilton-Hotels haben in Minibars investiert, die hochgehobene Flaschen automatisch auf die Rechnung setzen. Sogar Handtücher mit eingenähtem Diebstahlmelder wurden schon erprobt. Sie erwiesen sich jedoch als nicht waschmaschinenfest.
2. Die Abwertung der Trophäe: Der Wert eines Souvenirs liegt in seiner Unverwechselbarkeit. Darum sind viele Hotels dazu übergegangen, schwundanfällige Gegenstände nicht mehr mit Emblemen zu versehen. Das nimmt den Trophäenjägern die Freude. Bei ihnen hat sich auch die Jagderleichterung bewährt. So prangt an manchem Bademantel inzwischen der Hinweis, man könne ihn an der Rezeption erwerben. Das tut zwar kaum einer. Aber der Schwund geht zurück.
3. Appelle ans Gewissen: Den meisten Schwund beklagen große Vier-Sterne-Hotels – solche Häuser also, die einerseits Luxus zur Schau stellen, andererseits aber durch ihre Anonymität das »Hier kennt mich keiner«-Gefühl des Reisenden noch verstärken. Ob die einschlägigen Maßnahmen zur Kundenbindung daran viel ändern, mag dahingestellt sein. Aber sie haben offenbar einen disziplinierenden Begleiteffekt. Eine Anrede mit Namen – und schon merkt der Gast, dass er beachtet wie auch beobachtet wird. Einen solchen moralischen Weckruf haben einige Hoteliers auch ihren Wertsachen eingebaut. Auf den Rücken von Gemälden etwa prangt bisweilen ein Preisschild. Es geht auch weniger vornehm: mit dem Schriftzug »Hier wurde ein Bild gestohlen« an der rückwärtigen Wand.
4. Nichts tun: »Bei uns wird nichts festgeschraubt«, erklärt Marion Schumacher, die Sprecherin der Ritz-Carlton-Gruppe. Aus der Fünf-Sterne-Hotellerie hört man kaum Klagen über Schwund. Ob dort die Gäste vor lauter Zufriedenheit weniger klauen oder ob man bloß zu vornehm ist, darüber zu reden, bleibt das Geheimnis der Hoteliers. Marion Schumacher jedenfalls gibt sich großmütig: »Wenn ab und an mal ein Bademantel abhanden kommt, ist das ja auch eine Werbung für uns.«
5. Verzeihen: Die Hotelkette Holiday Inn rief in Amerika im vergangenen Jahr den »Towel Amnesty Day« aus. Allen Handtuchdieben wurde verziehen. Sie wurden sogar ermuntert, dem Unternehmen zu verraten, was mit den Handtüchern passiert ist. Rührende Geschichten kamen da zusammen: Wie junge Eltern ihr Baby darin wickelten. Wie die kleine Tochter zum ersten Mal mit ihren Eltern verreiste und im Hotel entzückt ausrief: »Die haben ja die gleichen Handtücher wie wir!« Wie einmal ein angehender Handtuchdieb eine aufgeschlagene Bibel neben seinem Koffer fand und fortan nicht mehr sündigte. Einer fragte sicherheitshalber, auf wie viele Handtücher sich die Vergebung erstreckt.
Konkurrenten des Holiday Inn zeigen sich von diesem Marketing-Gag wenig begeistert. Ermuntert man nicht so die Gäste zum fröhlichen Weiterklauen? Doch vielleicht bewirkt gerade die Vergebung mehr als das verschämte Gerede vom Schwund. Der Towel Amnesty Day spricht in aller Heiterkeit die Handtuchdiebe schuldig. Er holt ihre klammheimlichen Gaunereien ans Licht und nimmt ihnen gleichzeitig die Beichte ab.
Ich habe gestohlen
Mechthild Werner Handtücher
Ich war schon erwachsen, der Urlaub ein Revival: mit Eltern und Bruder in den Vogesen, wo wir als Kinder jeden Sommer verbracht hatten. Diesmal aber nächtigten wir luxuriös. Das Grand Hotel hatte wunderbare Handtücher, ganz flauschig und weiß und dick. Meine Mutter, selbst Pfarrersfrau, schimpfte präventiv: »Vergreift euch bloß nicht an fremdem Gut. Denkt an das Siebte Gebot.« So weit die Worte. Die Heimfahrt zeigte die Taten. Ich hatte mir ein Hotelbadetuch unter den Pulli geschoben. Meine Mutter hatte eins in der Handtasche versteckt. Mein Bruder wählte den Rucksack. Eine kleptomanische Pfarrersfamilie, vereint auf dem Autositz. Die Flauschetücher benutze ich noch immer. Manchmal ist mir das peinlich. Etwa wenn Fremde mein Bad benutzen und sehen, aha, Frau Pfarrerin stiehlt Hotelhandtücher. Damals aber dachte ich: So ein teures Hotel – das verkraftet ein bisschen Handtuchklau.
Mechthild Werner, 42, Pfarrerin, spricht am 4.September »Das Wort zum Sonntag« (ARD). Sie ist eine von acht Theologen im Team
-
Also, solange rüberkommt DASS es Spaß macht, ist die Wortwahl für mich sowieso eher nebensächlich :D. Wichtig ist, daß es zusammen paßt.
-
Hehe, echt klasse

-
Also schwingende Knüppel machen mich nun wirklich nicht an
 - aber etwas Phantasie bei der Wortwahl darf schon sein
- aber etwas Phantasie bei der Wortwahl darf schon sein  - aber wie Nicola sagte, das kann auch nach hinten losgehen
- aber wie Nicola sagte, das kann auch nach hinten losgehen 
Übrigens finde ich das gepostete Foto Klasse

-
Ich auch :D, aber der Schock muß für die Leute dort wirklich derb sein.
-
Joann Sfar - "Die Katze des Rabbiners"
[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,383815,00.jpg]
Die Katze des Rabbiners fraß den Papagei und konnte sprechen. Das ist nicht der Aufhänger zu einem Kinderbuch, sondern Anfang einer humorvollsten Geschichten über das Judentum, die je erzählt wurden. Denn die Katze ist nicht nur eigensinnig, sondern auch überaus gebildet. Also liefert sich dieser Garfield mit Kabbala-Kenntnissen theologische Dispute mit den Gelehrten, streicht nachts über die Dächer der Stadt und verlangt lautstark nach seiner Bar-Mizwa ebenso wie nach Streicheleinheiten. Joann Sfar, einer der produktivsten französischen Comicschaffenden zurzeit, erzählt pointiert vom Alltag einer nordafrikanischen jüdischen Gemeinde - stets aus der Vier-Pfoten-Perspektive. Dabei erweist er[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,383819,00.jpg]
Joann Starsich nicht nur als einfühlsamer, humoriger Erzähler, sondern auch als intimer Kenner der jüdischen Kultur, der alle theologischen Klippen geschickt umschifft - oder ganz bewusst auf ihnen aufläuft. Voller Staunen nimmt seine Katze wahr, dass selbst der gläubigste Mensch nur ein Mensch ist - inklusive aller Schwächen. In Frankreich längst ein Bestseller, erscheint diese schöne, tiefsinnige Geschichte in Deutschland beim rührigen Kleinverlag avant, der sich bei der Gelegenheit die Rechte an weiteren Sfar-Werken gesichert hat. Stefan Pannor
avant-Verlag, 48 S., circa 15 Euro
-
Seth - "Clyde Fans"/"Eigentlich ist das Leben schön"
[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,383836,00.jpg]
Seths halb-autobiografischer Comicroman "Eigentlich ist das Leben schön", im Original bereits 1996 erschienen, ist fraglos einer der besten Comics des vergangenen Jahrzehnts. Der Kanadier berichtet darin von seiner jahrelangen Obsession für Kalo, einem vergessenen Cartoonisten der dreißiger Jahre, dessen Leben und Werk er in einer aufwändigen Suche nachspürt. Dabei geht es natürlich vor allem um eine Sinnsuche im eigenen Leben. Seth entwirft das Portrait eines Mannes, der aus Angst vor der Gegenwart in eine nostalgisch verklärte Vergangenheit flüchtet. Auch wenn es diesen ominösen Kalo nie gegeben hat, ist doch der Rest des Bandes ziemlich real: Seth,[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,383838,00.jpg]
Seth
ewiger Nörgler mit Hang zur Misantrophie, inszeniert eine persönliche Nabelschau, die vor allem deshalb funktioniert, weil sie so unprätentiös ist. Immer wieder verlangsamt Seth die Geschichte und unterbricht sie durch Impressionen von Menschen und Landschaften. Das ist poetisch, von tiefer innerer Ruhe und bildet das nötige Gegengewicht zur Selbstinszenierung des Autors und Zeichners. Gleichzeitig zu diesem Band erschien der erste Band von Seths nicht weniger empfehlenswertem Comic-Roman "Clyde Fans", in dem er die Geschichte zweier ungleicher Brüder in den fünfziger Jahren erzählt. Stefan PannorEdition 52, 200 S., circa 20 Euro
-
Diverse - "Moga Mobo 100"
[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,383830,00.jpg]
"Moga Mobo" ist das Wunder der deutschen Comicszene. Seit zehn Jahren gibt es die Fanzines, erst aus Stuttgart, später aus Berlin. Der Clou: Alle Ausgaben sind gratis, finanziert durch Werbung. Exakt einhundert Hefte sind es jetzt geworden. Wer sie alle hat, besitzt praktisch ein Who-is-Who der deutschen Comicszene. Kaum ein Zeichner von Rang und Namen, der noch nicht in "Moga Mobo" publiziert hat. Dafür gab es diverse Comicpreise, zuletzt vor zwei Jahren den "Max & Moritz" in Erlangen. Zum Jubiläum erschien jetzt eine extradicke Ausgabe mit über 100 Seiten. Schwerpunkt sind natürlich die Comics, die sich allesamt um die große Frage drehen, warum erwachsene Menschen eigentlich so viel Zeit mit Bildgeschichten verbringen. Zusätzlich gibt es eine Reihe nostalgischer Texte ehemaliger Mitarbeiter. Das ist abwechslungsreich und macht Spaß auf höchstem Niveau. Stefan Pannor[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,383832,00.jpg]
Moga Mobo, 112 S., erhältlich unter www.mogamobo.com
-
Alan Moore/J.H. Williams III - "Promethea"
[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,383823,00.jpg]
Von 1999 bis 2004 gönnte sich Alan Moore, jüngst in den Ruhestand getretener Revolutionär des Mediums ("Watchmen", "From Hell"), den Luxus eines eigenen Comiclabels. Dort entstanden nicht nur die Abenteuer der "League of Extraordinary Gentlemen", sondern auch so eigenwillige Titel wie die Superhelden-Cop-Soap "Top 10" oder "Greyshirt", eine Hommage an Will Eisners "Spirit". Aus diesem Fundus ist "Promethea" die umfangreichste und persönlichste Arbeit. Ein Esoterik-Science-Fiction-Roman, in dem Moore seine ganz eigene Sicht der Welt vermittelt. Promethea ist keine Figur, sondern eine Idee, deren reale
[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,383828,00.jpg]
Moore / Williams III / GrayManifestationen über die Jahrhunderte Moore verfolgt. Als Sagengestalt, Comic-Heldin atemberaubende Kämpferin für Freiheit und Emanzipation. Eine Geschichte über Geschichten also, und eine über Magie. Unzählige Handlungsebenen, oft winzigste Parallelstränge, machen die Story zu einem komplexen intellektuellen Puzzlespiel. Das wäre sicher nur halb so spannend ohne die wunderbaren Zeichnungen von J.H. Williams, der den Leser mit ornamentaler Wucht, überbordendem Detailreichtum und einer guten Portion Kitsch bombardiert. "Promethea" ist eine skurril-poetische Melange von höchster erzählerischer Finesse, unnahbar und dennoch brillant. Stefan Pannor
Speed Comics, 180 S., circa 20 Euro
-
Die Täter konnten noch aus einem anderen Grund annehmen, ungestraft davonzukommen. Denn das Mädchen wurde nicht entführt: Sie hat sich mit den Männern freiwillig eingelassen. "Ein Mädchen, das mit einer Gruppe junger Männer ausgeht - was denkt ihr denn, was dann geschieht?", schrieb ein gewisser "Abu Usama" in einem der Internetforen. "Sie hat Schande über alles gebracht - über sich selbst, über ihre Ehre, ihre Religion und über ihre Familie. Wenn hier jemand eine Strafe verdient hat, dann sie."
Kontakte zwischen Männern und Frauen, die nicht eng miteinander verwandt sind, darf es in Saudi-Arabien nicht geben. Natürlich gibt es sie trotzdem. Über die Hälfte der Saudis ist unter 20 Jahren und damit in einem Alter, in dem nicht jedes Verbot kommentarlos abgenickt wird.
In einer informellen Umfrage unter Mädchen und jungen Frauen, die kürzlich in saudischen Foren verbreitet wurde, gaben 70 Prozent der Befragten an, Kontakte zu jungen Männern zu haben. Für viele von ihnen bedeutet das jedoch nicht, "mit den Jungen auszugehen." Das Abenteuer findet oft nur virtuell statt - per Telefon oder per Video-Chat im Internet.
Saudische Eltern sind angesichts der neuen technischen Möglichkeiten alarmiert. "Wisst ihr, was eure Töchter hinter eurem Rücken treiben?", ereifert sich einer, der im Internet Bilder von Mädchen entdeckt hat, die beim Chat in ihre Webcam blinzeln.
Beliebtestes Mittel der Kontaktanbahnung ist das Handy. Junge Männer kleben ihre Handynummer an die Autoscheibe oder lauern auf die Gelegenheit, sie in einer Einkaufs-Mall unbemerkt einem der schwarz verhüllten Wesen zuzustecken. Dann beginnt das Warten auf den Rückruf.
Ein pädagogischer Computer-Trickfilm der Initiative "Islamisches Web" befasst sich mit dem umgekehrten Fall: Ein junges Mädchen sitzt behütet in ihrem Heim, einer stilisierten Muschel, und träumt von einem Prinzen - dann klingelt plötzlich das Handy. Der Anrufer flirtet mit ihr, das Mädchen schmilzt dahin. Und sieht nicht, was sich ihr aus dem Display entgegenreckt: der Teufel in bunten Farben.
Schnitt, dann Nacht, es ist einsam: Die Muschel des Mädchens liegt verloren inmitten düsterer Ruinen. Ein Schatten. Die Klaue des Teufels packt, drückt die zappelnde Muschel, zerquetscht sie, während langsam Blut heraus rinnt. Man hört ein böses Kreischen. Die erzieherische Gegenoffensive setzt auf Schauermärchen.
Jetzt, wo ein solches Schauermärchen raue Wirklichkeit geworden ist, herrscht Panik - vor allem vor dem Handy. Kein Schleier hilft, wenn auch die Telefone Augen haben. Besonders auf Hochzeitsgesellschaften lauert die Gefahr, unbemerkt fotografiert zu werden. "Mittlerweile fürchten wir uns vor den Festsälen", schreibt ein Leser an eine große saudische Tageszeitung, "wer jetzt heiratet, hat Angst, dass keiner kommt".
Zwar feiern die Frauen strikt getrennt von den Männern. Aber sobald sie unter sich sind, fallen die schwarzen Hüllen. Da kann Frau so manches interessante Foto machen, beim "zufälligen" Herumnesteln am Handy, und dem Bruder in den Festsaal der Männer hinüberschicken. Und spätestens wenn der das Bild dann ins Internet stellt, ist es mit der Familienehre der Abgelichteten nicht mehr weit her.
Seit der per Handy-Cam mitgeschnittenen Vergewaltigung führt dergleichen nun schnell zu Zwischenfällen. In der Süd-Provinz Asir kam es auf einer Hochzeitsparty, als eine Frau beim heimlichen Fotografieren erwischt wurde, gleich zu einer Massenschlägerei - erst unter den Frauen, dann auch im Festsaal der Männer.
In Hail, einer Stadt im Norden des Landes, hat man jetzt eiligst den Beruf der Handy-Inspektorin erfunden. Am Eingang einer Festhalle postiert, haben die neuen Aufpasserinnen die alleinige Aufgabe, die Handys der Frauen auf Fotofunktionen zu kontrollieren. Die saudische Zeitung "Al-Watan" berichtet über große Akzeptanz.
Als Reaktion auf den Schock des Video-Skandals wirkt all das vielleicht ein wenig hilflos - aber der Trend zur Gefahrenabwehr ist nun auch Birgas D. und seinen beiden Helfern zum Verhängnis geworden. Die drei hatten auf eine andere Reaktion gesetzt: dass die Schande das entehrte Mädchen und ihre Familie trifft.
Doch geschockt von der Brutalität des Videos, hat sich die Waage der öffentlichen Meinung in Saudi-Arabien zur Verteidigung der Frau geneigt - gegen die Täter und gegen die Technik. Die Initiative "Eine Million gegen das Laster" will eine Million Hörkassetten verteilen, auf denen ein Prediger das Mobiltelefon verdammt. Und die mutmaßlichen Täter befinden sich mittlerweile in Haft.
Gerüchte kursieren, dass Birgas D. sich freiwillig gestellt habe - um der Rache der Familie des Opfers zu entgehen. Die Verwandten der Täter stehen unter Polizeischutz. Die Stimme des Volkes hat sich entschieden, die Foren im Internet sind voll davon. Manche Kommentare sind geschmückt mit Schwertern, und sie drehen sich langsam, wartend, um die eigene Klinge. Man will ihren Kopf. Den der Männer - diesmal.
Quelle: www.spiegel.de
-
SAUDI-ARABIEN
Der Teufel wohnt im HandyVon Michael Heim
Ein Verbrechen gegen eine Siebzehnjährige hat Saudi-Arabien erschüttert. Fassungslos sehen die Saudis, wie Szenen sexueller Gewalt, aufgezeichnet mit einem Video-Handy, im Internet die Runde machen. Ein Land fragt sich, ob Hightech-Telefone seine Traditionen aushöhlen.
Der junge Saudi schrieb nicht unter seinem richtigen Namen, und er tippte die Neuigkeit ziemlich aufgeregt ins Internetforum - Rubrik "heiße News", die Schmuddelecke. Er hatte das Foto einer jungen Frau entdeckt, heimlich gemacht mit einer im Handy eingebauten Kamera. Die anderen Forumsteilnehmer waren beeindruckt: Das Bild zeigte eine junge saudische Krankenschwester mit schönen Augen. Viel mehr sah man nicht. Denn sie war verschleiert.
All das war so harmlos, scheinbar - aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Denn auf einmal sehen die Saudis ganz andere Bilder. In dem Land, auf dessen Straßen sich Frauen nur komplett verschleiert zeigen dürfen, ist ein Video aufgetaucht: wieder mit einem Handy aufgenommen, und wieder zeigt es eine junge Frau, fast noch ein Mädchen. Aber diesmal trägt sie keinen Schleier. Sie liegt in einem fast leeren Zimmer auf einem Teppich, in Riad, die Beleuchtung ist grell. Und sie wird vergewaltigt.
Es gehört einiges dazu, um in Saudi-Arabien den Terrorismus und al-Qaida als Topthema zu verdrängen. Doch die Szenen des Videos haben das erzkonservative muslimische Land getroffen wie ein Schlag. Die Saudis schauen mit Entsetzen auf ein Verbrechen, mit dem sich die Täter auf bisher unbekannte Weise brüsteten. Und viele fragen sich, was mit ihrer Gesellschaft passiert ist, und ob Hightech und Verrohung vielleicht zwei Seiten derselben Medaille sind.
Die ersten Anzeichen, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist, gab es in den saudischen Diskussionsforen im Internet - wie immer. Denn in Saudi-Arabien, wo die offizielle Presse an der kurzen Leine gehalten wird, erscheinen heikle Themen in der sicheren Anonymität des Webs. Hier werden alle Informationen umgeschlagen, auch die unerwünschten, und heftig diskutiert - in oft seitenlangen Beiträgen. Im Internet zeigen sich die Saudis als ein Volk von Vielschreibern.
Dort war im vergangenen Monat auf einmal die Rede von einem Film. "Als ich heute ins Büro kam", schrieb einer, "saß mein Kollege vor dem Bildschirm und war ziemlich blass. Er sagte mir, wenn ich noch nicht gefrühstückt hätte, dann sollte ich mir das lieber nicht ansehen." Damit begann eine Lawine: der fassungslosen Kommentare, der neu entdeckten Details, der Empörung, der Grundsatzdiskussionen. Und der Neugier. Das Video verbreitete sich rasend - von Handy zu Handy, per E-Mail und über das Internet.
Dem Opfer, eine 17-jährige Schülerin aus angesehener Familie, wurde von dem 22-jährigen Birgas D., der zuvor bei ihr abgeblitzt war, eine kalt berechnete Falle gestellt. Er überredete den Ex-Freund des Mädchens zu einem gemeinsamen Racheakt. Die Männer lockten sie zu einem Treffen; dann ließen die beiden Saudis einen Mann über das Mädchen herfallen, der bei einer der Familien als Fahrer angestellt war.
Die Szene ist an Zynismus und Erniedrigung kaum zu überbieten. Während der Bedienstete das Mädchen vergewaltigt, erläutert ihr Birgas, der im Bild nicht zu sehen ist, mit ruhiger, kalter Stimme, was für ein Dreck sie sei. Die per Handy-Cam festgehaltenen Videosequenzen verschickten die Männer dann - mit dem Ziel, die Bilder möglichst weit zu verbreiten.
Die Täter achteten sehr darauf, dass das Gesicht ihres Opfers auf dem Video gut wiederzuerkennen ist. Dass auch der Name von Birgas D. fällt, hat ihn nicht davon abgehalten, den Film zu verbreiten. Die beiden Saudis in dem Täter-Trio stammen aus einflussreichen Familien. Offenbar rechneten sie damit, dass sie das vor Verfolgung schützen würde.
-
EIGENER MUSIKSHOP
Microsoft greift Apple anBislang dominierte Apple mit seinem iTunes Musicstore den Markt für Online-Musik. Das will Microsoft bald ändern und öffnete heute seinen eigenen Musikladen im Web. Die Preise sind wie bei iTunes: Ein Song kostet 99 US-Cent.
Der heute gestartete Musikshop von Microsoft steht zunächst nur Kunden aus den USA offen. Er firmiert unter dem Namen MSN Music Preview, und stellt, wie der Name nahe legt, eine Testversion des eigentlichen Shops dar, der Mitte Oktober starten soll. Unter der Adresse beta.music.msn.com finden sich derzeit nach Microsoft-Angaben rund 500.000 Titel.
Bei den Preisen orientiert sich der Softwarekonzern an Apples Musicstore: 99 US-Cent pro Song. Alben sind teilweise sogar billiger als bei Apple, wo sie 9,99 Dollar kosten. Mit Microsoft hat zweifellos der bislang mächtigste Herausforderer von Apple den Markt betreten.
Künftig sollen Microsoft-Kunden auf ein Repertoire von über einer Million Musikstücke zugreifen können. "Unser Ziel ist es, mit dem MSN Musik-Service digitale Musik einem Massenpublikum zugänglich zu machen, indem wir, wie wir glauben, den größten und qualitativ besten Katalog legaler Musik im Internet anbieten", sagte MSN-Chef Yusuf Mehdi. Er kündigte eigene Musikshops auch für Europa, Brasilien, Korea und Australien an.
Die Songs sollen über den Windows Media Player oder den Microsoft Internet Explorer heruntergeladen werden können und sind per Rechtemanagement (DRM) geschützt. Das DRM erlaubt das gleichzeitige Abspielen eines Titels auf fünf PCs und maximal sieben Brennvorgänge auf Audio-CD.
Marktforscher von Jupiter Research gehen davon aus, dass der Online-Musikmarkt von heute 270 Millionen Dollar bis zum Jahr 2009 auf insgesamt 1,7 Milliarden Dollar anwachsen wird. Derzeit beherrscht Apple den rasant wachsenden Markt unangefochten. Mit seinem Internet-Musikshop iTunes hielt das Unternehmen zuletzt einen Anteil von 70 Prozent. Den Verkauf seines MP3-Players iPod konnte Apple im dritten Quartal auf 830.000 Stück verdreifachen.
Auf einem iPod können bei MSN gekaufte Titel nicht abgespielt werden. Damit wäre nach vorläufigen Schätzungen mehr als ein Drittel aller Nutzer von MP3-Playern nicht in der Lage, MSN-Musikstücke abzuspielen. Bei Microsoft sieht man die Lage trotzdem gelassen. Der iPod sei lediglich in vier Prozent aller US-Haushalte vertreten, sagte Mehdi. Der Markt sei noch sehr jung. "Es gibt genug Leute, die noch keinen Player gekauft haben, so dass wir uns über die installierte Basis der iPods nicht sorgen."
Das Erfolgsmodell von Apple, der parallele Verkauf von MP3-Playern und darauf abspielbarer Musik, will Microsoft gleichwohl kopieren. Nach Angaben von Bloomberg soll in diesen Tagen der Verkauf eines neuen Microsoft-Players mit Windows-Betriebssystem für rund 500 Dollar beginnen. Ob er dem iPod das Wasser reichen kann, wird über den Erfolg des MSN-Shops mit entscheiden. Allerdings verweist Microsoft darauf, dass es rund 70 verschiedene MP3-Player gibt, die auch das WMA-Format unterstützen und somit MSN-Songs abspielen können.
Quelle: www.spiegel.de
-
Ähäm - tja... also die wirklichen Klasse-Frauen können zur Not auf den teuren Schnick-Schnack auch verzichten, aber GPS-Systeme sind natürlich kein Schnick-Schack sondern ganz wichtig im Kampf ums Überleben, wenn man sich in der Wildnis des Ruhrgebiets bewegt

-
Meins ist schon 2 Jahre alt - damals waren die noch deutlich teurer als jetzt :D. Ich habe damals ca. 500 EUR dafür ausgeben müssen inkl. Software. Das ist ne Menge Geld, aber auch ne Menge Spaß, die ich mir dafür eingekauft habe. Es gibt auch deutlich preiswertere Systeme, aber ich hatte konkrete Vorstellungen davon, was mein System leisten soll - naja und meine Vorstellungen sind eigentlich immer etwas kostpieliger

-
Also ich muß sagen, daß ich - seit ich ein GPS-System mein eigen nenne - sowieso meine nähere Umgebung neu entdecke. Ich fahre mit dem Teil Gegenden ab, die ich sonst vermutlich nie zu Gesicht bekommen würde, weil es mir sonst zu mühselig wäre, den Weg zu suchen. Ich finde die Dinger echt klasse und sehr hilfreich für Orientierungsgenies wie mich

-
Naja, also die Bestattungsformalitäten würden mich nun nicht gerade zum Auswandern bewegen

-
Endlich weiß ich, was ich mit meinem GPS-System anfangen kann
 - bisher habe ich es nur benutzt, um mich zurecht zu finden, aber da steckt noch viel mehr drin!
- bisher habe ich es nur benutzt, um mich zurecht zu finden, aber da steckt noch viel mehr drin!GPS-KUNST
Riesenelefant in Brighton[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,386652,00.jpg]
Wale, Katzen mit gesträubten Schwänzen, ein freundlich guckender Elefant: Zwei britische Künstler zeichnen mit ihrem GPS-Empfänger. Ihr Malbrett sind die Straßen ihrer Stadt, freie Felder und ganze Landstriche im Süden Englands.
Sie wählen nie den direkten Weg, wenn sie von A nach B wollen. Jeremy Wood und Hugh Pryor sind Karthographie-Künstler. Ihren Stift, das GPS-Gerät, haben sie immer im Gepäck. Es zeichnet die Wegpunkte ihrer Ausflüge auf. Die schönsten Schlangenlinien, die sie gelaufen und mit Fahrrad oder Auto gefahren sind, haben die beiden online gestellt.
[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,386567,00.jpg]
Das Größte "IF" der Welt entsteht beispielsweise, wenn man von Iffley in Oxfordshire nach Iford in East Sussex, von dort nach Ifield und zum Schluss nach Ifold in West Sussex fährt. Vorausgesetzt man zeichnet seine Route mit einem GPS-Gerät auf. In sechs Stunden und zehn Minuten ist das I gezeichnet (Länge 373 Kilometer), rund 14 Stunden brauchten die beiden für das F (490 Kilometer), eine nächtliche Pause inbegriffen.
[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,386573,00.jpg]
Manchmal ist es nur ein kleiner Spaziergang am Strand um einen Wal, der einem Fischschwarm hinterher jagt, auf den Bildschirm zu zeichnen. 67 Kilometer auf dem Fahrrad ergibt ein Schiff, dass munter durch die Stadt Brighton dümpelt. Das Auge eines Guppys ist der Rundgang um ein Dorf. Der Schwanz des Drachens ist leider nicht vollständig - ein Hügel stand im Weg.
[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,386576,00.jpg]
"Nie ohne mein GPS" scheint das Motto der Künstler zu sein. Aus Las Vegas brachten sie das Bild eines Dollar-Zeichens mit (96km), aus Bangkok eine Mücke (1,5km), gegen ein Trinkgeld fuhr ein Taxifahrer noch einen rund 14 Kilometer großen Kreis um das Insekt.
Auch Fallschirmsprünge, eine Reise im Flugzeug von Berlin nach London und die Irrfahrt um einen Verkehrskreisel (Fahrer und Beifahrer konnten sich nicht auf die Ausfahrt einigen), sind auf der Seite dokumentiert. Selbst den Weg eines Fallschirmspringers durch die Luft haben die beiden aufgezeichnet. Und die Gassi-Strecke ihres Hundes.
Wer will, kann sich auf der Seite dann noch selbst im Zeichnen probieren: Das GPS-Gerät ist dem Fall die Maus, die man über den Bildschirm bewegt.
[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,386578,00.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.spiegel.de/img/0,1020,386584,00.jpg]