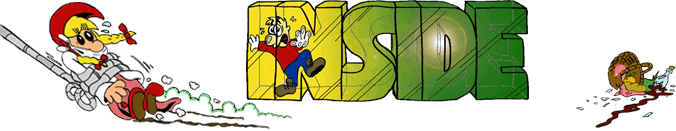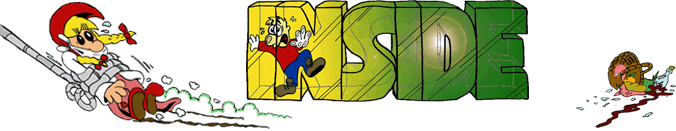Schmerz – NZZ Folio 01/07
«Mein Körper war ein Lächeln»
Bei starken Schmerzen hilft nur eines: Morphium. Geschichte einer Droge, die als Heil- und veRauschmittel Karriere machte. Von Andreas Heller
Er war erkältet, er hustete, er spuckte Blut. Mit stechenden Schmerzen in der Lunge schleppte er sich zum Arzt, der ihm eine Morphiumspritze verabreichte. Es war seine erste, und die Wirkung des Wundermittels vergass Friedrich Glauser sein Leben lang nicht mehr: «Plötzlich wurde ich ganz wach. Ein sonderbares, schwer zu beschreibendes Glücksgefühl ‹nahm von mir Besitz›», schrieb der Schweizer Schriftsteller später im Aufsatz «Morphium. Eine Beichte» über seine erste Erfahrung mit der Droge im Jahr 1917. «Trotzdem es mir damals materiell sehr schlecht ging, war alles plötzlich verändert, die Not hatte ihre Wichtigkeit verloren, sie war nicht mehr vorhanden, ich hielt das Glück in den Händen; es war, um einen schlechten Vergleich zu gebrauchen, so, als ob mein ganzer Körper ein einziges Lächeln wäre.»
Als Glauser eine Woche später ins Spital eingeliefert wurde, bediente er sich selber im Medikamentenschrank. Im Morphiumrausch schrieb er Gedichte, und als er das Krankenhaus verliess, war der 21-Jährige bereits an das Gift gewöhnt – ein Morphium-Junkie.
Morphium, auch Morphin genannt, ist Labsal für die Seele, es bläst die Sorgen weg wie ein Föhnwind dräuende Wolken. Gleichzeitig ist es seit über 200 Jahren die wirksamste Arznei gegen starken körperlichen Schmerz. Noch heute wird Tumorpatienten häufig Morphium verordnet. Das potente Schmerzmittel kommt zum Einsatz in der Notfallmedizin, bei Koliken und starken Rückenschmerzen, bei chronischen Schmerzen, die so stark sind, dass andere Behandlungsmethoden nicht mehr helfen; Morphium gehört zum Cocktail, mit dem der Anästhesist den Patienten in Narkose versetzt, und es erlöst die Sterbenden von ihren Qualen.
«Morphium ist so etwas wie der Goldstandard in der Schmerzbekämpfung», sagt Eli Alon, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes. «Das Mittel ist äusserst effektiv, sehr gut steuerbar und ausserdem relativ billig.» Auch die bei einer erhöhten Dosis auftretenden Nebenwirkungen wie Verstopfung und Übelkeit seien gut bekannt – ebenso das Suchtpotential, das man mittlerweile relativ gut im Griff habe, vor allem dank neueren Präparaten, die eine verzögerte Dosierung erlaubten, womit der euphorisierende Kick entfalle.
Was nicht heisst, dass eine Behandlung mit Morphium über einen längeren Zeitraum nicht abhängig macht. Wird die Behandlung abrupt abgesetzt, reagiert der Körper mit Entzugssymptomen wie Durchfall, Schwitzen oder Magenkrämpfen. Auch eine psychische Abhängigkeit ist nicht ausgeschlossen. Studien beziffern das Risiko der Sucht bei einer längeren medizinischen Behandlung zwischen 3,2 und 18,9 Prozent. Die Rheumatologin Christine Sengupta warnt deshalb vor einer leichtfertigen Verschreibung bei anhaltenden Schmerzen. «Vor allem bei Patienten, die psychische Probleme haben, wird die Gefahr einer Abhängigkeit oft unterschätzt.» Die Bekämpfung des Schmerzes ist irgendwie immer mit der Herbeiführung einer Sucht verbunden. Betrachtet man die Geschichte der Schmerzmittel, erscheint dies gleichsam als Naturgesetz.
Beginnen wir beim Opium, dem Ausgangsstoff des Morphiums. Der getrocknete Milchsaft des Schlafmohns wurde bereits bei den Sumerern, Assyrern und Ägyptern als Heilmittel verwendet. Im Vordergrund stand allerdings weniger die schmerzstillende als die schläfrigmachende Wirkung. Sie war es auch, die den römischen Dichter Ovid faszinierte und dazu inspirierte, den Wohnsitz von Morpheus, dem Sohn des Schlafgottes Hypnos, an die Pforte der Unterwelt zu verlegen, in deren Umgebung Mohnblüten ihre üppige Pracht entfalteten.
Griechische und römische Schriftsteller und Ärzte, die grossen christlichen wie auch die arabischen Enzyklopädisten der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrtausends berichteten in immer differenzierterer Form über die innerliche und äusserliche Anwendung von Opium bei verschiedenen Krankheiten. Opium brachte die Ruhr zum Stehen und löste Magenkrämpfe, es wurde verschrieben gegen Husten, Gelenk-, Kopf-, Leber- oder Milzschmerzen. «Er ist betäubend und stillt jeden Schmerz», schrieb der griechische Arzt Claudius Galenus. Und im Mittelalter mischte Paracelsus aus Opium, Wein und Bilsenkraut sein Laudanum, das sich bis weit ins 19. Jahrhundert hinein grosser Beliebtheit erfreute.
Schon früh war Opium aber nicht nur als Arznei, sondern auch als Rauschdroge bekannt und begehrt. Um 1500 kam in Persien, in der Türkei und in Indien das Opiumessen auf – allein um des Rausches willen. Gegen Mitte des 17. Jahrhunderts begann man in China, den Stoff zu rauchen. Wenig später wurde seine berauschende Wirkung auch in Europa entdeckt, zunächst vor allem von den Literaten der Romantik, die dank der Droge in magische Sphären der Dichtung vorzustossen glaubten.
So etwa Thomas de Quincey (1785–1859), der in seinen «Bekenntnissen eines englischen Opiumessers» seine Drogenerfahrung ausführlich dokumentierte. Beredt rühmt de Quincey «die Freuden des Opiums», einer Droge, welche die geistigen Fähigkeiten des Menschen in «erlesenste Ordnung, Gesetzmässigkeit und Harmonie» überführe und «den göttlichen Teil seines Wesens emporsteigen» lasse. Er beschreibt neben der «Sanftmut» der Droge aber auch ihren «rächenden Schrecken»: «Nacht für Nacht schien ich – nicht metaphorisch, sondern buchstäblich – in Schlünde und sonnenlose Abgründe zu versinken, in Tiefen, aus denen emporzusteigen es keine Hoffnung gab.»
Während die Dichter – neben de Quincey auch Novalis, Heinrich Heine, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe und viele andere – mit dem Opium in die Abgründe ihrer Seelen tauchten, machten sich die Naturwissenschafter gegen Ende des 18. Jahrhunderts neugierig und hellwach auf die Suche nach den Wirkstoffen in dieser Wunderdroge. 1803 gelang es Charles L. Derosne, aus dem Opium ein Salz herauszuwaschen, das er unter dem Namen «Sel de Derosne» in Umlauf brachte; spätere Analysen zeigten, dass es sich dabei um eine Mischung der beiden Alkaloide Morphium und Narkotin handelte.
Zur gleichen Zeit experimentierte in Paderborn ein junger Apotheker, Friedrich W. Sertürner, in seinem einfachen Labor ebenfalls mit wässrigen Auszügen aus Opium. Mit verdünnten Säuren und Laugen extrahierte und filtrierte er daraus eine kristalline Substanz. Er verfütterte sie seinen Hunden, worauf die Tiere einschliefen. Sertürner schloss daraus, dass diese Substanz das «schlafmachende Prinzip» des Opiums sei, und nannte sie Morphium, nach dem Gott des Schlafs und des Traums, Morpheus.
Nach einigem Zögern probierte der Apotheker den aus dem Opium gewonnenen Stoff mit drei jugendlichen Freunden selber aus. Jede der Versuchspersonen nahm in Abständen eine Gesamtdosis von 97,5 mg Morphin zu sich – ein Quantum, das die vier Männer buchstäblich flachlegte. Bei seinen Freunden registrierte Sertürner «eine vorübergehende Neigung zum Erbrechen», einen «dumpfen Schmerz im Kopfe mit Betäubung», darauf «Ermattung und starke, an Ohnmacht grenzende Betäubung». Er selber dämmerte in einem «traumartigen Zustand» dahin. Die Isolierung des Morphins beendete eine jahrtausendelange Unsicherheit bei der Verwendung von Schmerzmitteln.
Nun stand erstmals ein exakt dosierbares Analgetikum zur Verfügung. 1818 beschrieb der französische Arzt François Magendie, wie er erfolgreich die Schmerzen eines Mädchens behandelt hatte. 1827 begann die Darmstädter Firma Merck mit der industriellen Morphiumproduktion. Der Stoff wurde zuerst oral eingenommen. Nach der Entwicklung von Spritze und Hohlnadel ging man dazu über, das Medikament intravenös zu verabreichen. So wirkte der Stoff schneller und stärker.
Vor allem in den Feldlazaretten wurde viel Morphium gespritzt, im amerikanischen Sezessionskrieg (1861–1865), im Krimkrieg (1853–1856), im Deutsch-Französischen Krieg (1870/71). Oft gab man den Verwundeten die Morphiumspritze selbst in die Hand, und die machten ausgiebig davon Gebrauch. Zahllose Soldaten wurden abhängig und kamen zeitlebens nicht mehr von der Droge los. In Amerika war bald von der «soldiers’ disease» die Rede.
Auch viele Ärzte, Literaten, Professoren und Prostituierte verfielen der Morphiumsucht. Der Chirurg Franz König aus Göttingen berichtete, dass beim Kaffee-Skat im Ärztecasino die Morphiumspritze «von Hand zu Hand ging, wie jetzt die Zigarettendose». In Paris trafen sich die Damen der besseren Gesellschaft in speziellen Salons zu Injektionskränzchen. Fabergé, der Modedesigner der Zeit und ein weltbekannter Schmuckhersteller, lieferte die wohl teuersten Spritzen, die es je gab: in massivem Gold und mit Emaildekor.
Die neue Arznei, die Schmerzen so gut linderte, wurde zum Suchtmittel wie zuvor das Opium, und der verbreitete Konsum zum alarmierenden sozialen Problem. Bereits 1872 warnte der deutsche Psychiater Heinrich Laehr vor dem «Missbrauch der Morphium-Injectionen». Es sei die Kehrseite der grossen Erfolge der Morphiumtherapie, dass das «Publikum» angefangen habe, sich den Stoff selber zu verordnen, so dass manche gleich zur Morphiuminjektion griffen, wenn sie bloss eine unbehagliche Stimmung spürten. Ähnlich argumentierte Carl Ludwig Alfred Fiedler in Dresden, der in einem 1874 erschienenen Aufsatz vor allzu sorglosem Umgang warnte und die Manie mancher Ärzte scharf rügte, die Injektionsspritze aus der Hand zu geben und diese dann der Willkür des Kranken oder seiner Angehörigen zu überlassen.
Den Begriff «Morphiumsucht» prägte schliesslich 1877 Eduard Levinstein, Chefarzt an der Berliner Maison de Santé, in einer umfassenden Abhandlung zum grassierenden Morphiumkonsum. Als von der Sucht besonders gefährdete Gesellschaftsschicht betrachtete Levinstein die «gebildeten und höheren Kreise», die über die finanziellen Mittel zur Morphiumbeschaffung verfügten.
Wie beim Opium fehlt es auch beim Morphium nicht an literarischen Zeugnissen der Sucht. Jules Verne, der Morphium gegen chronische Schmerzen nahm, liebte das Mittel als «Göttertrank»: «Stich deine feine Nadel hundertmal hinein, ich will dir hundert Segenswünsche sagen; Und Äskulapens Gottheit wird Morphine sein.» Hans Fallada gab seinem letzten Manuskript den ironisch-frivolen Titel «Sachlicher Bericht vom Glück, ein Morphinist zu sein». Er nannte das Morphium seine «einzige Geliebte». Wenn sie ihn besuchte, war für ihn das Leben schön: «Es ist so sanft, ein glücklicher Strom wallt durch meine Glieder dahin, in seinen Strömen bewegen sich alle kleinen Nerven zart und sacht wie Wasserpflanzen in einem klaren See.» Und wenn diese Geliebte nicht da war, litt er Höllenqualen, es war «wie ein kleiner Tod». Das war mehr als nur eine Metapher. Am Ende starb Fallada an einer Überdosis.
Friedrich Glauser, der Schöpfer des gemütlichen, brissagorauchenden Wachtmeisters Studer, durchlebte alle Höhen und Tiefen eines Süchtigen. Er starb, erst 42-jährig, am Tag vor seiner Hochzeit. Ein nicht weniger bedrückendes Beispiel ist Klaus Mann, der seine Abhängigkeit im Roman «Der Vulkan» sowie in der Autobiographie «Der Wendepunkt» literarisch verarbeitet hat.
Auf der politischen Ebene bewirkte die seit Mitte des 19. Jahrhunderts grassierende Morphiumsucht eine Reihe von Reglementierungen, die den freien Gebrauch sukzessive einschränkten. Derweil konzentrierten die Pharmazeuten ihre Forschung auf ein Schmerzmittel, das nicht süchtig machen sollte. 1873 entwickelte der englische Chemiker C. R. Wright ein Verfahren zur Synthetisierung des Diacetylmorphins, eines Produkts aus Morphin und Essigsäureanhydrid. 1896 griff die Aktiengesellschaft Farbenfabriken, der heutige Bayer-Konzern, das Verfahren auf und liess den Stoff unter der Bezeichnung Heroin patentrechtlich schützen. Zwei Jahre später begann die industrielle Produktion des Stoffs. Das Heroin wurde vor allem als Hustenmittel verschrieben, aber auch als Heilmittel gegen Morphiumsucht.
Was den Husten angeht, erfüllte sich die Hoffnung: Heroin ist in der Tat hustenstillend. Bald stellte sich jedoch heraus, dass der Versuch, Husten mit Heroin zu heilen, ungefähr so sinnvoll war wie der Versuch, Blattläuse mit Bomben zu bekämpfen. Heroin fuhr noch stärker ins Gehirn als Morphium und machte noch schneller süchtig. Als Medikament wurde es deshalb in den meisten Ländern bald wieder aus dem Verkehr gezogen. Umso steiler war der Aufstieg des Heroins in der Drogenszene, wo es das Morphium mehr und verdrängte.
Für die Schmerzbekämpfung hingegen blieb Morphium unersetzlich. Weiterhin versuchte man, die süchtigmachende Komponente des Morphiums zu eliminieren – vergeblich. Dafür fand man heraus, wie das Morphium wirkte: es unterbindet als Agonist an den sogenannten Opioidrezeptoren die Schmerzweiterleitung im Körper und reduziert ausserdem die Empfindlichkeit der sensiblen Nervenzellen im peripheren Nervensystem. Wenig Mühe bereitete der Wissenschaft die synthetische Herstellung des Medikaments. So entwickelten die Pharmafirmen im Lauf der Zeit eine unübersehbare Zahl von Morphinderivaten wie Methadon, Fentanyl, Tramadol, Buprenorphin oder Palladon. 1963 synthetisierten zwei schottische Wissenschafter ausserdem aus Thebain einen halbsynthetischen Verwandten des Morphins – Etorphin. Dieser Stoff ist rund tausendmal stärker als Morphium und wird unter dem Handelsnamen Immobilon oder M 99 ausschliesslich bei Tieren angewendet, etwa zur Betäubung von Elefanten.
Ein entscheidender therapeutischer Fortschritt für den Menschen indes gelang erst mit der Entwicklung des retardierten Morphins im Jahr 1983. Dank der Verdoppelung des Dosierungsintervalls von 4 auf 8 Stunden muss das Medikament nur noch dreimal am Tag eingenommen werden, was die Lebensqualität der Schmerzpatienten verbessert; bei einer verzögerten Morphiumwirkung entfällt auch der euphorisierende Kick, der süchtig machen kann. Den vorläufigen Endpunkt der Entwicklung auf dem Gebiet der Opioide für die Schmerztherapie stellen die mit Fentanyl und Buprenorphin angereicherten Pflaster dar, die auf der Haut direkt an der schmerzenden Stelle appliziert werden. Eine solche Behandlung eignet sich vor allem für die Dauertherapie schwerer chronischer Schmerzen und hat in den letzten Jahren die traditionelle Morphiumbehandlung mehr und mehr verdrängt. In Deutschland entfallen mittlerweile mehr als die Hälfte der Opioidbehandlungen auf sogenannte transdermale Präparate.
Für die Behandlung von Tumorschmerzen gilt die Abgabe von Morphium jedoch weiterhin als Standardmedikation. Der Stoff wird dabei meist oral als Tablette abgegeben, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten. Bei akuten Schmerzen wird in Einzelfällen auch gespritzt – und wer das einmal erlebt hat, wird die Wohltat des Morphiums tatsächlich sein Leben lang nicht mehr vergessen.
Es war ein peinigender, stechender Schmerz, der vom Rücken in die Lende ausstrahlte. Ein Schmerz, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Ein Schmerz, der mich winseln liess. Der Arzt diagnostizierte Nierensteine, so klein, dass sie sich weder operativ noch mit einem Zertrümmerer entfernen liessen. Das Einzige, was er tun konnte, war, den Schmerz zu bekämpfen – mit Morphium. Das Wort jagte mir damals noch Angst und Schrecken ein.
Aber der Arzt blieb ungerührt. Er präparierte die Spritze. Er stach zu. Nach wenigen Minuten entfaltete der Stoff seine segensreiche Wirkung. Nach einer halben Stunde war der Schmerz wie weggeblasen. Wurde ich euphorisch wie Friedrich Glauser? Das nicht gerade, wenn ich mich recht erinnere. Aber der Schmerz war weg, und das allein war bereits ein verdammt gutes Gefühl.
Trend zu starkem Stoff
23,2 Millionen Packungen Schmerzmittel im Wert von rund 140 Millionen Franken werden in der Schweiz jährlich verkauft. Zum grossen Teil sind dies sogenannte Nichtopioid-Analgetika, die nicht nur schmerzdämpfend, sondern auch entzündungshemmend und fiebersenkend wirken. Beispiele sind Acetylsalicylsäure (Aspirin), Ibuprofen, Diclofenac oder Naproxen. Auch Analgetika auf der Basis von Paracetamol oder Metamizol gehören in diese Kategorie. Das in der Schweiz unter allen Schmerzmitteln am häufigsten verkaufte Produkt ist Dafalgan mit dem Wirkstoff Paracetamol. Auf den weiteren Rängen folgen Perfalgan und die Migränemittel Imigran und Zomig. Eine Kategorie für sich sind die Opioid-Analgetika mit Morphin als Prototyp. 800 000 Packungen werden von diesen Schmerzmitteln jährlich abgesetzt – Tendenz klar steigend. Das am häufigsten verschriebene Produkt in dieser Kategorie ist Tramadol, ein schwach wirksames Opioid, das im Unterschied zu den meisten anderen Opioiden nicht dem Betäubungsmittelgesetz untersteht.
Andreas Heller ist NZZ-Folio-Redaktor.