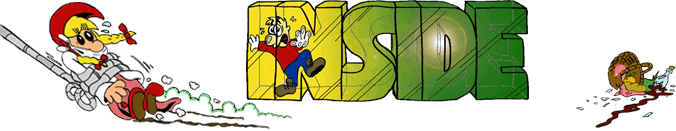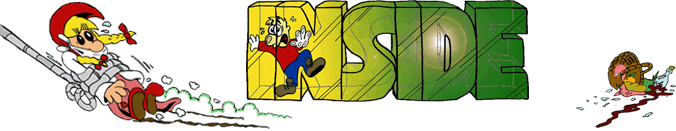Kasten: Neue Serie: «Die Zukunft von gestern»
Die Zukunft von gestern (1)
Die Vergesslichkeit der Wissenschaft
Jules Vernes «Reise zum Mittelpunkt der Erde»
Der Grundeinfall des 1864 von Jules Verne verfassten Romans scheint die Wissensgier der letzten hundertfünfzig Jahre und den wilden Galopp der Technikentwicklung schadlos überstanden zu haben: Ein Gelehrter entdeckt, wie man über einen isländischen Vulkan in ein natürliches Schachtsystem absteigen kann, und wagt den Vorstoss in die Tiefe der Erde.
Schon zu Jules Vernes Zeiten war dominante Lehrmeinung, dass es dort unten nur geschmolzenes Gestein und flüssiges Metall zu finden gebe. Aber bis in unsere Tage fehlt es an den technischen Möglichkeiten, der herrschenden Theorie über die «Eingeweide der Erdkugel» Evidenz zu verleihen. Ähnlich wie die Weiten des Weltalls bleibt uns die Mitte unseres Planeten unerreichbar. Diese Fallhöhe zwischen Wissensgewissheit und praktischer Ohnmacht bildet das energetische Potenzial, auf das Jules Verne spekuliert. Wer das Unmögliche in die Tat umsetzt, muss, so will es die Logik des Abenteuers, Spektakuläres erleben. Und die Phantasie wird den gewagtesten Einfällen folgen, so sich der Lesende mit den Protagonisten der grandiosen Unternehmung identifizieren darf.
Auf drollige Art bieder
Die Figuren, die Verne hierzu anbietet, wirken, gemessen an der Kühnheit der Handlungsidee, auf eine fast drollige Art bieder. Die Expedition wird angeführt von Professor Lidenbrock, nicht nur ein führender Geologe, Mineraloge und Chemiker seiner Zeit, sondern auch umfassend historisch gebildet und ein veritables Sprachgenie. Er verkörpert den idealen Gelehrten des 19. Jahrhunderts, der ganz dem Fortschritt der Wissenschaft lebt und in allen anderen Belangen der Existenz einen rechten Kauz abgibt. Sein Neffe Axel, der Ich-Erzähler des Romans, ist sein braver Schüler, ohne jedoch über die gleichen Talente und Ambitionen zu verfügen. Axels Vorstellung von der Zukunft, seine utopische Potenz, erschöpft sich zunächst vollständig darin, sich eine Ehe mit Gudrun, dem Patenkind seines Onkels, auszumalen. Dem Abstieg zum Mittelpunkt der Erde sieht er mit Bangen entgegen, am liebsten würde er das Abenteuer verhindern, um seinen Traum von ehelicher Zweisamkeit und familiärer Häuslichkeit nicht zu gefährden.
Die Ängstlichkeit Axels, sein Hang, jeglichem Risiko aus dem Wege zu gehen, bildet einen reizvollen, oft tragikomisch zugespitzten Kontrast zum rücksichtslosen Wissenwollen seines Onkels. Professor Lidenbrock verschwendet keinen Funken Denk-Energie auf den Umstand, dass man sich ohne einen Plan für den Rückweg in ein verwirrendes Labyrinth begibt. «Wir sind nicht hierhergekommen, um vorsichtig zu sein», meint sein Neffe verzweifelt, als sie auf einem unterirdischen Meer in Lebensgefahr geraten.
Dieser Ozean, den ein gewaltiges Firmament aus Granit überwölbt und dessen Atmosphäre elektrische Entladungen erhellen, ist vielleicht die schönste Erfindung des an Einfällen wahrlich nicht armen Romans. Das Lidenbrock-Meer, wie es sogleich getauft wird, bedeutet eine Welt in der Welt, einen Miniatur-Erdkreis, der alles, was unsere irdischen Gefilde an Reizen besitzen, in komprimierter Form vorweist: die Fülle der unbelebten Materie, eine komplexe Pflanzen- wie Tierwelt aus allen Epochen der Naturgeschichte und sogar einen riesenhaften Urmenschen als Krone der rundum verkapselten Schöpfung.
Gewaltiges Naturkundemuseum
Allerdings enthält das phantastische Reich, so stupend für den Leser Szene auf Szene auch sein mag, nichts wirklich Neues. Es ähnelt eher einem gewaltigen Naturkundemuseum, in dem Verne uns von einem perfekt ausgeleuchteten Exponat zum nächsten führt. Alle Entdeckungsfahrten, von denen Verne in seinen Romanen erzählt, haben dieses unverhohlen archivarische Verhältnis zum Neuen. Im Arrangement wirken die Tableaus seiner Handlungen originell, aber stets sind sie aus Bekanntem, aus Bruchstücken des zeitgenössischen Wissens, zusammengebastelt. Die Jules- Verne-Forschung hat viele seiner Quellen ausfindig gemacht. Selbst der für das Handlungsjahr 1863 futuristisch anmutende «Ruhmkorffsche Apparat», eine batteriegespeiste Röhrenlampe, die den Forschern durch die Unterwelt leuchtet, war kurz vor der Niederschrift des Romans als Sicherheitsgrubenlicht konstruiert worden.
Allzu rasant dem Happy End entgegen
Also wäre «Reise zum Mittelpunkt der Erde» womöglich gar kein frühes Meisterwerk der Science- Fiction, zu deren Wesen doch gehört, dass eine naturwissenschaftlich inspirierte, zumindest naturwissenschaftlich kostümierte Spekulation auf eine Zukunft gewagt wird, die unerhört Neues zu bieten hat?
«Ich vergass die Vergangenheit, ich kümmerte mich nicht um die Zukunft», sagt Axel, kurz bevor er, berauscht von den bisherigen Entdeckungen, mit einer katastrophalen Idee das rücksichtslose Weiterwollen seines Onkels übertrumpft. Beim Versuch, sich den Weg freizusprengen, verursachen sie ein Erdbeben und zerstören die eben erst entdeckte unterirdische Welt.
In rasantem Tempo geht es daraufhin dem Happy End entgegen. Fast scheint es, der Autor möchte die Gewalttat seiner Helden umgehend vergessen machen. Im Schlot eines ausbrechenden Vulkans sausen wir mit ihnen nach oben. Kein Wort mehr über das, was man hinter sich lässt. Als Axel in den Armen seiner Gudrun liegt, ist ihm und seiner Wissenschaft glücklich entfallen, dass man eine lebende Vergangenheit unwiederbringlich dem Tod überantwortet hat. Der Wissenserwerb vernichtet die Lebendigkeit des Erkannten - für Jules Verne wie für uns eine alte und zugleich neue Einsicht, die selbst immer wieder zunichtewerden muss, damit wir unbekümmert an die Zukunft glauben können.
Georg Klein
Der deutsche Schriftsteller Georg Klein, Jahrgang 1953, lebt am Dollart in Ostfriesland. Zu seinen wichtigsten Werken gehören die Erzählungen «Anrufung des blinden Fisches», die Detektivgeschichte «Barbar Rosa» sowie der Roman «Die Sonne scheint uns». Im März legt er im Rowohlt-Verlag den neuen Roman «Sünde Güte Blitz» vor.
Neue Serie: «Die Zukunft von gestern»
A. Bn. Unsere Gegenwart ist der Zukunft in fast ausschliesslich einer Weise zugewandt - sie erwartet von ihr nur das Schlimmste. Klimaerwärmung und globale Seuchen, Gentech-Missbrauch und entfesselte Migration, Kampf der Kulturen und atomarer Terror, Überalterung und Energieknappheit heissen die Bedrohungsszenarien, die uns umtreiben. Menschheitsdämmerung ist angesagt. Dabei ist es noch nicht lange her, dass in Politik, Wissenschaft und Kultur fast durchweg das Prinzip Hoffnung herrschte. Mittlerweile sind die utopischen Träume verpufft, ist die Gewissheit, trotz Rückschlägen auf eine bessere Welt zuzusteuern, an der Dialektik des Fortschritts zerschellt.
Obsessiv und hysterisch scheint unser Verhältnis zur Zukunft zu sein - ein Umstand, der sich mannigfaltig in Literatur und Kunst niederschlägt. Immer schon gab es Werke, die unseren Hoffnungen und unseren Ängsten, unseren kühnsten Phantasien und schlimmsten Träumen archetypisch Ausdruck verschafften. Und doch wird jede Utopie, jede Dystopie, vom Zeitgeist verstossen und von der technischen Entwicklung überholt, historisch. Die Zukunft - sie hat ihre Geschichte. In einer neuen Feuilleton- Serie wollen wir in unsystematischer Weise der «Zukunft von gestern» nachgehen, wie sie sich in literarischen Werken präsentiert. Klassiker sollen ebenso zur Sprache kommen wie weniger Bekanntes. Der ferne Spiegel dieser Bücher soll eine Übung in Selbsterkenntnis sein - er dürfte uns uns selbst oft verschwommen, dann aber auch wieder in bedrängender Nahaufnahme zeigen.
http://www.nzz.ch/2007/02/09/f…leETV7P.html#topofarticle