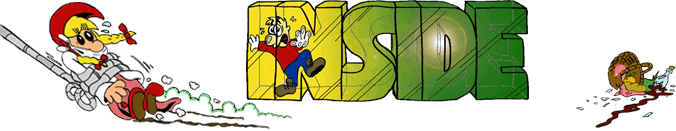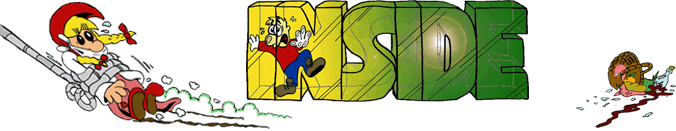Gunhild Küblers Kolumnenband „Noch Wünsche?“ lässt keine Wünsche des Lesers offen
© Die Berliner Literaturkritik, 18.06.08
ZÜRICH (BLK) – Im Dörlemann Verlag ist 2008 Gunhild Küblers Kolumnenband „Noch Wünsche?“ erschienen.
Klappentext: In ihren in der NZZ am Sonntag erscheinenden Kolumnen notiert Gunhild Kübler Einbrüche des Unerwarteten, Unerwünschten und Unheimlichen in unseren Alltag. Sie kratzt an der Oberfläche tagesaktueller Debatten, hinterfragt wohlfeile Erklärungen und findet dabei zu eigenen verblüffenden Antworten, die zum Selberdenken verleiten. Sie schreibt über Zivilcourage, über die Hochdeutschen in der Schweiz, über neuste Imageprobleme des Feminismus und das Recht auf Selbstbestimmung bis in den Tod hinein. Und sie geht der Frage nach, warum es uns so selten gelingt, glücklich zu sein. Gunhild Küblers Kolumnen sind pointiert geschriebene kleine Essays, die über den Tag hinausgehen, Spiegelungen von Alltäglichem, die unsere Gesellschaft in kurzen Aufrissen erhellen. Zugleich sind sie aber auch die Spiegelung eines klugen offenen Kopfes mit genauem Auge und empfindlichem Ohr.
Gunhild Kübler, geboren 1944, studierte Germanistik und Anglistik in Heidelberg, Berlin und Zürich. Sie war Literaturkritikerin bei der Neuen Zürcher Zeitung, Redakteurin der Weltwoche und schreibt heute für die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag. Von 1990 bis 2006 war sie Mitglied im Kritikerteam der Sendung „Literaturclub“ des Schweizer Fernsehens. Seit Jahren vertieft sie sich zudem ins Werk der großen amerikanischen Lyrikerin Emily Dickinson und hat inzwischen 600 ihrer Gedichte ins Deutsche übersetzt und herausgegeben (Hanser, 2006). Ihre Übertragung wurde für den Preis der Leipziger Buchmesse 2007 nominiert. Gunhild Kübler lebt in der Nähe von Zürich. (lea/wip)
Leseprobe: © Dörlemann ©
Der grüne Strahl
Ein Vorwort
Vor einigen Jahren erzählte mir eine Freundin eine Geschichte, die von einem kleinen, alten, struppigen Hund handelte. Er soll in einer italienischen Villa zu Hause gewesen sein. Aber nie hätte dieses zerrupfte Wesen, das mit krächzender Fistelstimme bellte und auch vom Aussehen her mehr einem Huhn als einem Hund glich, sich auf dem Rasen und schon gar nicht in den edel möblierten Zimmern blicken lassen dürfen.
Eigentum der Köchin und ein Küchenhund sei er gewesen, ein Prolet im Vergleich mit den graziösen, seidenweich behaarten Windspielen, die zur Villa gehörten. Einmal sei sie schlaflos wegen der Hitze nachts die Treppe hinunter in den kühleren Empire-Salon geschlichen und dort im Mondlicht auf einem der kostbaren Sofas eingenickt. Da plötzlich sei der Küchenhund aufgetaucht, habe eine Runde durch den Salon gezogen, dabei gegen jedes einzelne Möbelstück das Bein gehoben
und so sein Reich markiert.
Sie habe ihn später noch so manche Nacht heimlich dabei beobachtet, ihn aber nie verpetzt, bis er tot war. Diese hübsche Geschichte wollte die Freundin, eine Schriftstellerin, in eine längere Erzählung verwandeln, deren Thema das Aufbegehren gegen eine Hackordnung wäre. Doch fand sie, ihre Küchenhund-Story sei ergänzungsbedürftig. Eine gute Geschichte, sagte sie, müsse mehrstimmig
sein. Man brauche dazu zwei verschiedene Plots, die sich ergänzten, kommentierten, korrigierten, kontrapunktisch begleiteten; der Text werde dadurch mehrdimensional.
In ihre Küchenhundgeschichte müsse also noch eine zweite Geschichte, am besten ebenfalls zum Thema Hackordnung, hineingesteckt werden. Man sieht, diese Schreiberin hat Ambition, Durchblick und Erfahrung. Und dann vergingen mehrere Jahre, bis ihr ein zweiter, zum Küchenhund passender Plot einfiel. Gut Ding will Weile haben, und trotz jahrzehntelangem Schreibtraining fällt einem nicht schon deswegen viel ein, weil man viel schreiben muß. Kolumnisten aber sollen schnell, regelmäßig und pünktlich Manuskripte liefern für einen zeilengenau auskalkulierten, knappen Raum.
In der Themenwahl bin ich bei meiner Kolumne frei, was eine wunderbare Möglichkeit und zugleich – während einer Einfallsflaute – eine Plage sein kann. Das in Zeitungsartikeln sonst so verpönte „ich“ ist hier am Platz, weil hier die eigene Meinung vertreten und nachvollziehbar begründet werden soll. Ich erfinde nichts, alle Details sind echt, sie beziehen sich auf reale Ereignisse, Beobachtungen und Erfahrungen, manchmal auch auf Romane, Erzählungen, Essays, Sachbücher und Filme.
Wenn der zeitliche Abstand zwischen den Kolumnen ein Monat ist, wie in meinem Fall, hört sich das komfortabel an. Engpässe und Panik vor dem leeren Blatt gibt es aber trotzdem. Mit der Zeit habe ich mir deswegen eigens Textbaustellen eingerichtet, wo sich Kolumnenmaterial ansammeln kann und zur Kombination anbietet. Denn auch für diese halbliterarische Textsorte gilt, was die aus ihrem professionellen Nähkästchen plaudernde Freundin fürs Schreiben von Erzählungen festhält: Je mehr Dimensionen ein Text hat, umso weniger verpufft er.
Manchmal ergeben sich Kombinationen wie von selbst. Manchmal nicht. Dann ragt eine einzelne Geschichte jahrelang isoliert auf meiner Baustelle auf wie bei der Freundin die vom frechen Küchenhund. Kein kontrapunktischer zweiter Plot will sich finden, weswegen ich nicht aufhören kann, sie in Gedanken zu umkreisen. Gibt es vielleicht Geschichten, die keine andere neben sich dulden? So eine ist meine Geschichte mit dem grünen Strahl.
Sie handelt von einer Art Naturwunder, das man selten bei Sonnenuntergängen über dem Meereshorizont oder (noch seltener) im Hochgebirge zu sehen bekommt. Und natürlich ist der grüne Strahl auch ein Gerücht, seit Jules Verne in seinem Roman Le Rayon Vert (1882) seine Farbe als ein „Grün des Paradieses“ beschrieben und Eric Rohmer hundert Jahre später einen Film mit gleich lautendem Titel darüber gedreht hat.
Es war zu erwarten, daß der französische Regisseur eines Tages auf das Phänomen kommen mußte. Schon bei Jules Verne gab der grüne Strahl jedem, der ihn erblickte, das Versprechen, in Liebesdingen für immer Bescheid zu wissen. Und in der Tat hat dieses Phänomen etwas strahlend Geheimnisvolles wie die Liebe, etwas, über das sich endlos reden, spekulieren und theoretisieren, das sich hundertmal praktisch anbahnen, aber niemals herbeizwingen und schon gar nicht festhalten läßt.
Für eine Beobachtung des grünen Strahls muß der Blick zum Horizont frei, die Luft klar und sauber sein. Das Phänomen selbst kommt durch die Brechung des Lichts der untergehenden Sonne zustande, deren letztes Lichtsegment in seine Spektralfarben zerlegt wird, so daß am oberen Rand der Sonne, kurz bevor sie ganz hinter dem Horizont verschwunden ist, für einen Augenblick das grüne Lichtsegment erscheint. Vor länger dauernden Beobachtungen der untergehenden Sonne mit bloßem Auge oder mit optischen Instrumenten wird übrigens gewarnt, es heißt, sie führten zu permanenten Augenschäden.
Hier soll nicht aufgelistet werden, wo in der Welt ich mir wie viele Sonnenuntergänge über Meer und Gebirge konzentriert und andächtig angeschaut habe, einzig um diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Unglaublich, wie viele spektakuläre Sonnenuntergänge es gibt, die, sobald man sie mit einer gewissen Erwartungshaltung besichtigt, als völlig mißraten bezeichnet werden müssen. Weil die Aussicht auf den Horizont verbaut ist, weil die West-Ausrichtung des Beobachtungsfelds nicht ganz stimmt, weil die Luft zu feucht ist und sich Wolken oder Nebelschleier bilden, weil sich Segelboote, Lastkähne, Ausflugsdampfer, Passagierschiffe etc. im entscheidenden Moment vor den Himmelskörper schieben. Oder vorbeilaufende Spaziergänger.
Weswegen ich mehrfach die am Abend verlassenen Hochsitze der Strandaufsicht als Aussichtskanzel erklomm. Dort saß ich dann im Badeanzug wie im Schauspielhaus. Dabei ging es mir wie den jungen Leuten in Rohmers Film – ich bekam den Strahl nicht zu Gesicht. Mit der Zeit wurde mir klar, daß meine Obsession mir nichts als optische und emotionale Defizite verschaffte. Mit dem Warten auf das Unerhörte vergällte ich mir Erlebnisse, die eigentlich ganz schön gewesen wären. Weil ich mir jedoch dieses spezifische Warten nicht mehr abgewöhnen konnte, gewöhnte ich mir lieber das Betrachten von Sonnenuntergängen gleich ganz ab.
Ich registrierte das Schauspiel fast nicht mehr. Mit der Zeit wurde es mir unwichtig. Und dann stand ich mit Freunden eines Abends auf einem knapp über dem weißen Sandstrand des westaustralischen Perth gelegenen Parkplatz, der mit herumrollenden Pet-Flaschen und anderen Abfällen übersät war. Wir hatten nach einem langen, heißen Tag im Supermarkt eingekauft und beluden nun den Kofferraum des Autos, während am klaren Himmel rechts von uns die Sonne langsam ins Meer sank, ein Vorgang, den ich gedankenlos und nur noch aus dem Augenwinkel verfolgte.
Wie so oft lag die Sonnenscheibe erst wie flachgedrückt auf dem Horizont, gleich darauf war sie schon halb unten, dann verschwand sie, und im selben Augenblick schoß ein Strahl überm Meer empor, ein Strahl von einem, wie es bei Jules Verne heißt, „in der Natur sonst nicht vorkommenden Grün“. Schoß auf mich zu wie ein leuchtstoffröhrengrüner Speer. Und war weg. Das war umwerfend, und ich fragte mich unwillkürlich, ob das womöglich ein Zeichen war, und wenn ja, wofür? Und doch hatten die wenigsten Leute auf dem Parkplatz etwas davon bemerkt.
Unter den Umstehenden war die Erscheinung nur bei einem einzigen angekommen wie bei mir, und wie sich zeigte, war das einer, der ebenfalls seit Jahren zu den Jägern oder besser: zu den Jüngern des grünen Strahls gehörte. Item? Bestimmte Erfahrungen im Leben kann man nicht herbeizwingen; man lehnt sich besser zurück und läßt sie auf sich zukommen – oder eben nicht. Interessant ist dabei, daß man blind sein kann für etwas, das man nicht erwartet hat. – Aber gilt nicht auch noch ein drittes Fazit, eines, das schon Jules Verne in seinem Roman gezogen hat?
Da lassen zwei Liebende nach langem Warten die Erscheinung achtlos an sich vorbeischießen. Im entscheidenden Moment haben diese beiden nur Augen füreinander. Wer also den grünen Strahl nicht sieht und in seiner Sehnsuchtshaltung verharrt, gehört der vielleicht, so könnte man folgern, nicht am Ende doch zu denen, die mehr von der Liebe verstehen als alle, die das Phänomen gesehen haben und glauben, es damit endgültig zu erfassen?
Wie dem auch sei, eines ist klar: Diese Geschichte büsst viel von ihrem Zauber ein, wenn man ihr ein Fazit abzuzapfen versucht. Wie das wunderbare Phänomen selber läßt sie sich für nichts in Anspruch nehmen, illustriert im Grund einzig die Naturgesetze. Als Kolumnenmaterial scheint sie mir daher nur bedingt geeignet. Verteufelt schade. Umso mehr freut es mich, daß ich sie hier, anstelle eines Vorworts, einmal erzählen kann.
© Dörlemann ©
Literaturangaben:
KÜBLER, GUNHILD: Noch Wünsche? Kolumnen. Mit einem Nachwort von Jürg Altwegg. Dörlemann Verlag, Zürich 2008. 192 S., 18,90 €.
Verlag
Dörlemann Verlag