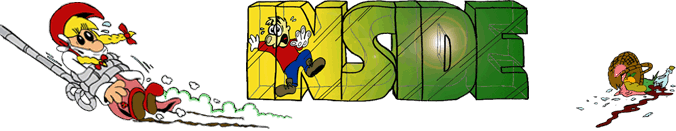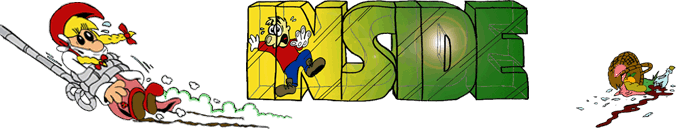- Offizieller Beitrag
Warum Medizinerinnen auf Gemälden nach Brustkrebs suchen
Tumore und Nervenschäden: «Ikonodiagnostiker» schliessen von Kunst auf Krankheiten. Über ein ungewöhnliches Forschungsgebiet, das auch Medizinstudierenden helfen kann.

In Michelangelos «Die Sintflut» sitzt eine Frau mit verdächtig verformter Brust.
Foto: Andreas Nerlich
In Kürze:
- Michelangelos «Die Sintflut» zeigt möglicherweise eine Frau mit Brustkrebs.
- Die Anomalien wurden durch eine ikonodiagnostische Zusammenarbeit von Experten entdeckt.
- Interdisziplinäre Teams erforschen medizinische Details in historischen Kunstwerken.
- Ikonodiagnostik hilft auch Medizinern bei der Ausbildung und der Wahrnehmung von Krankheiten.
Manche Diagnosen kommen definitiv zu spät. In dem Fall, um den es hier geht, liegen sogar mehr als 500 Jahre zwischen dem Auftreten des Leidens und der Identifizierung der Krankheit. Dabei hat sich die Patientin grösstenteils entkleidet, sodass die fragliche Körperregion auf Anhieb gut zu sehen ist. Es braucht jedoch offenbar den geschulten Blick von Pathologinnen, um zusammen mit Kunsthistorikern und Tumorexpertinnen zu erkennen, worum es sich handelt.
Die Rede ist von Michelangelos Gemälde «Die Sintflut», die einen Teil des Deckenfreskos der Sixtinischen Kapelle in Rom ausmacht. Doch obwohl Abertausende Besucher das weltberühmte Kunstwerk in der Kuppel bereits bestaunt haben, war medizinische Detektivarbeit nötig, um zu erkennen, dass links vorne in der Darstellung eine Frau mit Brustkrebs abgebildet ist.
Im Fachmagazin «The Breast» hat der Pathologe und Rechtsmediziner Andreas Nerlich von der Ludwig-Maximilians-Universität München nachgezeichnet, wie er im interdisziplinären Team zu der Diagnose kam. Die Krankheitszeichen auf dem 1508 entstandenen Werk können demnach als Symptome eines oberflächlich gelegenen Brustkrebses gedeutet werden.

«Die Sintflut» von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle.
Foto: Andreas Nerlich
Die rechte Brustwarze ist deformiert und der Warzenhof narbig eingezogen, während an der linken Brust keine pathologischen Veränderungen festzustellen sind. Im oberen Bereich der rechten Brust sind zudem mittig und zur Seite hin kleine Vorwölbungen zu sehen, die auf einen Knoten und geschwollene Lymphknoten hindeuten könnten. Beides sind Veränderungen, die auftreten, wenn der Krebs in die nächste Umgebung gestreut hat.
Nicht immer haben die dargestellten Kranken gelebt
Aus Kunst auf Krankheiten zu schliessen, ist unter dem Begriff «Ikonodiagnostik» zu einer kleinen, feinen Spezialdisziplin geworden. Der Begriff geht auf Anneliese Pontius zurück, eine Harvard-Psychiaterin, die 1983 in prähistorischen Kunstwerken aus dem Pazifikraum Gesichtsfehlbildungen beschrieb. «Wir sind inzwischen eine Gruppe Interessierter aus verschiedenen Ländern mit medizinischem, historischem und kunsthistorischem Hintergrund und tauschen uns zu besonderen ‹Fällen› aus», sagt Nerlich. «Die interdisziplinäre Herangehensweise hilft, um zu einer mehr oder weniger sicheren Diagnose zu kommen.»
Nicht immer haben die dargestellten Kranken gelebt. Im Fall der jungen Frau, die auf Michelangelos Meisterwerk zu sehen ist, soll mit der Krankheit, die auch als Mammakarzinom bezeichnet wird, das Sündige und Schlechte sowie der unausweichliche Tod dargestellt werden. Andere Menschen, die vor der nahenden Flut flüchten, symbolisieren die sieben Todsünden. Die Guten werden auf der Arche Noah im Hintergrund des Gemäldes gerettet.
Die junge Frau hat muskulöse Arme und Schultern – weil vor allem Männer Modell standen?
Dass Michelangelo den Brustkrebs einer jungen Frau als Symbol für die Verderbtheit des Menschengeschlechts ausgewählt hat, könnte Betrachter irritieren. 85 Prozent der Krankheitsfälle betreffen Frauen jenseits der 50. In der Renaissance lag die Lebenserwartung nur bei 35 Jahren. Das aber lag hauptsächlich an der hohen Kindersterblichkeit; wer die Kindheit überlebte, konnte deutlich älter werden.
Und es ist bekannt, dass Michelangelo bereits ab dem Alter von 17 Jahren bei Leichenöffnungen zugegen war und daher Fälle des familiären Mammakarzinoms gesehen haben könnte, das 5 bis 10 Prozent aller Brustkrebsfälle ausmacht und in jüngeren Jahren auftritt. Ein weiteres Detail: Die mit Krebs dargestellte Frau hat muskulöse Arm- und Schulterpartien. Eine Erklärung, warum hier Frauenbrüste auf einem Männerkörper zu sehen sind, könnte darin liegen, dass Männer damals öfter Modell standen oder zum androgynen Ideal jener Zeit muskulöse Oberkörper gehörten.
Auch von Rembrandt gibt es das Bildnis einer Frau mit Brustkrebs; er kannte sich offenbar ebenfalls mit dieser Pathologie aus. Von dem 1658 entstandenen Bild «Halb angezogene Frau neben einem Ofen» gibt es jedoch verschiedene Varianten: eine mit oberflächlich erkennbarem Brustkrebs und spätere Abbildungen ohne Tumor. Wahrscheinlich, so die Vermutung der Experten, liess sich das Porträt einer gesunden Frau besser verkaufen.
Neben der Brust sind auf unbedeckten Körperregionen wie Hals und Gesicht naturgemäss öfter Zeichen von Krankheit oder Verletzung zu sehen, so etwa auf dem Volckamer Epitaph in der Sebalduskirche in Nürnberg. Ein Sandsteinrelief stellt den Judaskuss dar und einen Tempelwächter, der einige Narben im Gesicht trägt. Für eine Lippenspalte sind die Läsionen zu ausgeprägt, wahrscheinlich handelt es sich um Schnitt- oder Stichverletzungen.

Auf dem Gesicht des Mannes ganz rechts im Bild sind Deformationen zu erkennen.
Foto: Sebalduskirche
Eindeutig zu erkennen ist hingegen die Pathologie in dem im Biedermeier entstandenen Porträt der Eleonore Feldmüller. Das 1837 von Ferdinand Georg Waldmüller gemalte Bild entstand kurz vor dem Tod der damals 62-jährigen Dame aus der Wiener Oberschicht. Es zeigt einen ausgeprägten Kropf. Die geröteten Wangen, der müde Gesichtsausdruck und deutliche Tränensäcke unterstützen neben dem aufgedunsenen Leib die Blickdiagnose Schilddrüsenunterfunktion. Das Hertoghe-Zeichen, also ausgedünnte seitliche Augenbrauen, kommt bei diesem Krankheitsbild ebenfalls häufiger vor.
Ein Geistlicher mit Madelung-Syndrom
Ein dicker Hals, wenn auch aus anderen Gründen, findet sich auch auf einem anderen Kunstwerk, einem Wandteppich aus dem 14. Jahrhundert, der in einem Museum in Padua zu sehen ist. Dort ist ein Geistlicher abgebildet, dessen Hals, Nacken und Schultern massiv angeschwollen sind. Die Darstellung deutet auf ein Madelung-Syndrom hin, eine gutartige Störung der Fettverteilung, die erhebliche Ausmasse annehmen kann.
Im 19. und 20. Jahrhundert sind die Kunst- und Medizindetektive bisher seltener zu ikonodiagnostischen Befunden gekommen als in den Jahrhunderten zuvor. «Wegen der zunehmend weniger gegenständlichen Kunst nimmt die Zahl entsprechender Beispiele in diesen Epochen ab», sagt Nerlich. Ausnahmen gibt es dennoch, etwa die Darstellung einer Lähmung des Gesichtsnervs bei Jules Verne und weitere Beispiele von Brustkrebs.
Damit Spekulationen nicht überhandnehmen und Krankheiten auf Kunstwerken leichtfertig festgestellt werden, haben die führenden Ikonodiagnostiker im Jahr 2023 Leitlinien für ein seriöses Vorgehen aufgestellt und zudem angeregt, immer den «Level of Evidence», also die Sicherheit der historisch-medizinischen Diagnose anzugeben.
Kunstwerke können Studierenden dabei helfen, Krankheiten zu erkennen
Neben der Faszination für das interdisziplinäre Zusammenspiel von Medizin und Kunst hat die Ikonodiagnostik durchaus praktischen Nutzen. «Unser Hauptziel ist es, die Wahrnehmung von Krankheit und den Umgang damit in früheren Zeiten zu verstehen», sagt Nerlich. «Ein weiteres Ziel besteht darin, das diagnostische Auge zu schulen.»
In Studien wurde gezeigt, dass Medizinstudenten und Auszubildende in Medizinfächern manche Krankheiten und deren Diagnostik besser lernen konnten, wenn sie ikonodiagnostische Beispiele kannten. «Wir haben Pläne, eine entsprechende Lehrplattform aufzustellen», sagt Nerlich. Noch fehle dafür aber die notwendige Unterstützung und Förderung.
Vielleicht würde sich diese leichter finden, wenn der potenzielle Nutzen erweitert würde. Zumindest anekdotisch kursiert die Geschichte, wonach der Besucher eines New Yorker Museums – ein Arzt – auf einem detailgenauen zeitgenössischen Bild eine kleine Wucherung am Auge des Porträtierten erkannte. Der aufmerksame Mediziner suchte den Mann auf, dieser fand bei seinem Arzt die Diagnose bestätigt und liess sich baldmöglichst operieren. Kunst kann also nicht nur anregend und lehrreich sein, sondern auch heilsam.
Quelle: https://www.derbund.ch/warum-medizine…en-694333055724