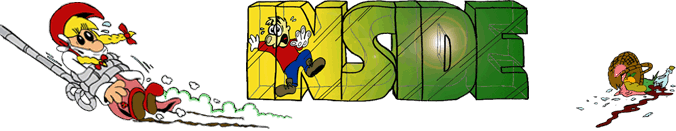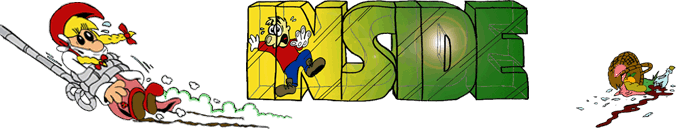- Offizieller Beitrag
Ralf Junkerjürgen hat eine neue Biografie über Jules Verne geschrieben. Im Interview erzählt er, was ihn an diesem Menschen besonders fasziniert und klärt, ob Verne einst in der Oberpfalz gewesen ist.
Jules VerneBild: Felix Tournachon
von Stefan Voit
In Frankreich zählt Jules Verne zu den vielgelesenen Autoren, seine Werke sind immer noch Schullektüre. Aber auch in Deutschland erfreuen sich seine Klassiker nach wie vor großer Beliebtheit. Die Kulturredaktion hat sich mit Ralf Junkerjürgen (49), seit 2007 Professor für romanische Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg, unterhalten. Er hat eine Biografie über den französischen Autor geschrieben.
ONETZ: Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Jules-Verne-Geschichte?
Ralf Junkerjürgen: Wie die meisten Kinder und Jugendlichen in den 1970er Jahren entdeckte ich Jules Verne über das Fernsehen. Während der Feiertage wurde am späten Nachmittag eine Verfilmung von Vernes erstem Roman, „Fünf Wochen im Ballon“, und wenig später eine weitere von „In achtzig Tagen um die Welt“ gezeigt, die mich begeisterten und die Fantasie in exotische Welten führten. Die Romane habe ich erst sehr viel später gelesen.
ONETZ: Was hat Sie daran besonders fasziniert?
Neben den bunten Abenteuern und der spannenden Handlung faszinierte mich die Vorstellung, eine Reise im Ballon zu machen. Die Gondel schien mir ein gemütlicher Ort zu sein, in dem man sich in die Welt und in Abenteuer begeben konnte, ohne sich ihr unmittelbar aussetzen zu müssen. Der Ballon erschien mir so reizvoll wie Kindern ein Baumhaus, wo sie außerhalb der Reichweite der Erwachsenen sind, zugleich aber einen Blick von oben genießen, der die Welt kleiner und überschaubarer macht.
ONETZ: Es gibt etliche Biografien über Jules Verne. Worauf haben Sie bei Ihrem Buch den Schwerpunkt gelegt?
Mir war es wichtig, Jules Verne aus einer kulturhistorischen Perspektive zu betrachten. Seine Bedeutung ist im Gegensatz zu einigen anderen Abenteuerautoren des 19. Jahrhunderts in den letzten zwei Jahrzehnten stetig angewachsen. Ich führe dies darauf zurück, dass er in vielerlei Hinsicht modern geblieben ist. Damit meine ich nicht allein die Rolle der Technik in seinem Werk, sondern auch die Art und Weise, wie die Welt verstanden wird: vernunftgeleitet, gestaltend, forschend und pragmatisch. Natürlich steht daneben auch so einiges, was veraltet ist, wie zum Beispiel der Glaube an die zivilisatorische Überlegenheit der Europäer.
Einen besonderen Schwerpunkt bildete für mich auch das konfliktive Verhältnis zwischen Verne und seinem Sohn Michel, der es als Sohn eines der bekanntesten Schriftsteller offenbar nicht geschafft hat, sich eine eigene stabile Identität aufzubauen. Michel ist sein Leben lang unstet geblieben, und in frühen Jahren war er so aufbrausend und problematisch, dass Verne zu dem härtesten Mittel griff, welches das Gesetz jener Zeit erlaubte: Er ließ ihn in eine Erziehungsanstalt einsperren. Gefruchtet hat dies alles jedoch nichts. Verne hat seinen Sohn bis ans Lebensende finanziell unterstützen müssen und litt schwer unter dessen Eskapaden wie Ehebruch und uneheliche Kinder. Für den streng katholisch erzogenen Verne waren dies familiäre Katastrophen, die sein Leben überschatteten.
ONETZ: War es leicht, an Quellen, Bücher, Briefe zu kommen?
Die Jules-Verne-Forschung hat sich in den letzten zwanzig Jahren vorbildlich entwickelt. Die bedeutende Korrespondenz Vernes mit seinem Verleger Hetzel wurde in mehreren Bänden herausgegeben, und in der berühmten Pléiade-Ausgabe, die umfangreich kommentiert ist, sind erstmals eine Reihe von Romanen Vernes erschienen. Weiterhin hat die französische Nationalbibliothek eine große Menge an Originalausgaben eingescannt, die man online einsehen kann. Die Bibliothek von Nantes wiederum bietet zahlreiche Romanmanuskripte im Netz an. Um die bisher unveröffentlichte Korrespondenz von Verne mit seinem Sohn Michel und weitere Dokumente einzusehen, habe ich einige Wochen in der Bibliothek von Amiens verbracht, die Vernes Nachlass aufbewahrt.
ONETZ: Jules Verne wird ja immer wieder gerne als „Vater der Science-Fiction“ bezeichnet. War er das wirklich, oder war er nur immer auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklungen und Wissenschaften und hat dies in seinen Romanen ungesetzt?
Jules Verne hat mit Science-Fiction, wie wir sie heute verstehen, nicht viel zu tun. Er inszeniert zwar Technik, orientiert sich jedoch weitgehend an den Möglichkeiten seiner Zeit und bleibt immer im Rahmen des physikalisch Möglichen. Dies unterscheidet ihn deutlich von H. G. Wells, mit dem er gegen Ende des Jahrhunderts häufig verglichen wurde. Für Wells jedoch spielte die Physik keine große Rolle, er wollte mit seinen Romanen zur Zeitreise, zu Mondflügen und Kriegen gegen Außerirdische eher die Fantasie anregen.
Jules Verne war selbst kein Wissenschaftler, sondern hatte Jura studiert. Daher hat er sich in jedes Thema zunächst eingearbeitet und fleißig einführende Literatur studiert und Spezialisten zurate gezogen. Er war in dieser Hinsicht sehr gewissenhaft, weil er wusste, dass die Qualität seiner Romane auch von der Qualität seiner Recherchen abhing. Der Erfolg hat ihm recht gegeben. Zwar ist einiges, was er beschreibt, heute wissenschaftlich natürlich überholt – vor allem bei seinen kühnsten wissenschaftlichen Romanen, der „Reise zum Mond“ und der „Reise um den Mond“. Dennoch waren seine Texte in der Lage, die spätere Wissenschaft zu inspirieren. So hat Hermann Oberth, ein Pionier in der Entwicklung des Raketenantriebs, in der Jugend Jules Verne gelesen und daraus wichtige Ideen für seine eigene Forschung gezogen.