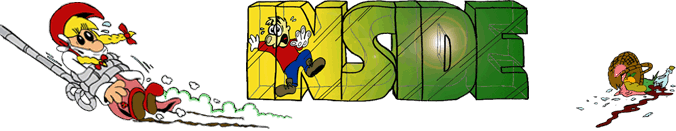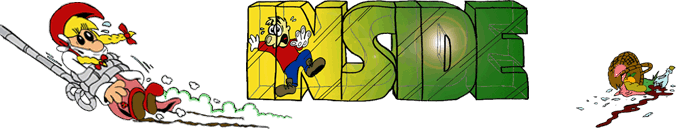- Offizieller Beitrag
Legendäre Klassiker
„Drei ???“, „TKKG“, „Fünf Freunde“, „Hui Buh“ – das goldene Zeitalter der Hörspiele
Von Martin Klemrath
Hörspiele: Vom Radio wurden sie erfunden, auf Schallplatten und Kassetten wurden sie Verkaufsschlager. Quelle: Martin Klemrath
Am 12. Oktober 1979 erschien „Der Super-Papagei“ – einer von vielen Hörspiel-Klassikern jener Zeit, die vor allem die Jugend begeisterten. Entstanden war das Genre in den 1920ern durch das Radio. Ein Hörspiel versetzte Zuhörer sogar in Panik.
Die Sonne geht wieder früher unter, die Abende werden immer länger, und dies ist für viele eine willkommene Gelegenheit, die alte Hörspielsammlung hervorzuholen. Oder nach Neuware Ausschau zu halten. Und so ist es vielleicht kein Zufall, dass einige Klassiker des rund 100 Jahre alten Genres ausgerechnet im Oktober erschienen sind.
Darunter ist ein Werk eines damals erst 23 Jahre alten Autors, Schauspielers und Regisseurs, der am Vorabend von Halloween 1938 ein denkwürdiges Kapitel Hörspiel-Historie schrieb: Orson Welles. Drei Jahre, bevor er mit „Citizen Kane“ einen der bedeutendsten Beiträge zur Filmgeschichte ablieferte, schickte er anlässlich des alljährlich zum Ende des Oktobers in den USA zelebrierten Gruselfestes eine Inszenierung in den Äther, die seither als berühmtestes Hörspiel der Rundfunkgeschichte gilt.
Die Radiohörer an Amerikas Ostküste erlebten ein akustisches Spektakel, das sehr realistisch gestaltet war – vielleicht zu realistisch: Auf dem Sender CBS unterbrach ein Sprecher nach dem Wetterbericht um 20 Uhr das Programm für eine „Sondernachricht“. Ein Professor aus Chicago habe eine Entdeckung gemacht: Offenbar hätten sich auf dem Planeten Mars einige Explosionen ereignet. Nun nähere sich ein Objekt der Erde, mit hoher Geschwindigkeit. Dann folgte zunächst Musik, und die verdutzten Zuhörer warteten gespannt auf das nächste Update zum Geschehen.
Bald darauf wurden Blitze und Himmelserscheinungen vermeldet; dann hieß es, eine 30 Meter breite Scheibe sei in Grover’s Mill, New Jersey, gelandet. Eine Invasion von Außerirdischen sei in vollem Gange, die mit Hitzestrahlen und anderen überlegenen Waffen angriffen und gegen die selbst schwere Artillerie der US-Truppen nichts ausrichten könne. Vom Dach eines Hochhauses schilderte ein Reporter in Manhattan dramatische Szenen: Bürger würden in den Straßen vor riesigen Kriegsmaschinen der Marsianer und deren Giftgas-Waffen fliehen. Dann hustete der Reporter und verstummte.
Viele Hörer ahnten nicht, dass sie keine realen Nachrichten verfolgten, sondern einer Adaption von H.G. Wells’ Roman „Krieg der Welten“ lauschten. Sie nahmen das Geschehen für bare Münze und riefen in Panik bei dem Radiosender an, in dessen Telefonzentrale nun alle Lichter angingen und Hektik ausbrach. Auch bei der Polizei liefen die Leitungen heiß, die Beamte zu CBS in New York schickte. Bei dem Sender trafen bald auch diverse Reporter ein, und in den folgenden Tagen erschienen etliche Berichte über die „Massenpanik“, die Welles mit seinem Radio-Drama ausgelöst hatte.
Heute geht man zwar davon aus, dass das Ausmaß der Angelegenheit in der Presse übertrieben dargestellt wurde und weit weniger Zuhörer verängstigt waren als später geschildert. Aber dennoch ist die Episode ein beeindruckendes Beispiel dafür, welch große Wirkung ein Hörspiel entfalten kann – mit begrenzten Mitteln. Im Gegensatz zu Film und Theater kann das Publikum das Geschehen nicht sehen, nur hören, was das Genre zunächst weniger attraktiv erscheinen lässt. Aber der vermeintliche Makel macht tatsächlich den besonderen Reiz von Hörspielen aus: Die Fantasie wird angeregt; und was man nicht sieht, kann sich in der Vorstellung viel intensiver anfühlen als manches, was man optisch vorgesetzt bekommt.
Erst populär im Rundfunk – dann legendär auf Kassetten
Zum Zeitpunkt von Welles’ Coup, der ihn landesweit bekannt machte, war das Genre Hörspiel noch vergleichsweise jung, aber bereits sehr populär. Seine Entstehung verdankte es einer technischen Neuerung: dem drahtlosen Rundfunk. Dessen Grundlagen schufen Ende des 19. Jahrhunderts, nachdem Heinrich Hertz 1886 die elektromagnetischen Wellen entdeckt hatte, Forscher wie Nikola Tesla und Guglielmo Marconi. Der erste kommerzielle Radiosender ging 1920 in Pittsburgh (US-Bundesstaat Pennsylvania) in Betrieb. In Berlin sendete nach einigen Feldversuchen ab 1923 der erste offizielle deutsche Radiosender. Die folgenden Jahre brachten den weltweiten Durchbruch des Radios als erstem elektronischen Massenmedium. Neben Nachrichten, Sport- und Musikübertragungen fanden nun Hörspiele ein breites Publikum.
Als weltweit erstes „Radio-Drama“ gilt die Adaption des Theaterstücks „The Wolf“, die der kleine Rundfunksender WGY im US-Bundesstaat New York am 3. August 1922 ausstrahlte. Statt einer bloßen Lesung wurden hierbei neben der Sprache auch (mit allerlei trickreich eingesetzten Hilfsmitteln erzeugte) Geräusche sowie Musik eingesetzt. Das kam beim Publikum derartig gut an, dass den Sender mehr als 2000 begeisterte Zuschriften erreichten. Die Hörer wollten mehr davon, und umgehend legte WGY mit neuen Produktionen nach. Das fand bald auf der ganzen Welt Nachahmer. Bis in die 1930er- und 1940er-Jahre erlebte das Genre eine erste Blütezeit. Doch im Laufe der 1950er begann das Interesse in den USA abzuebben, denn das neue Medium Fernsehen begann, dem Radio den Rang abzulaufen.
In Deutschland setzte hingegen in der Nachkriegszeit ein wahrer Hörspiel-Boom mit hunderten Produktionen pro Jahr ein. Dazu trugen die damaligen, anfangs kargen Verhältnisse bei. Viele Kinos und Theater waren zerstört, aber Radios noch in großer Zahl vorhanden. Das Fernsehen schaffte hierzulande nach bescheidenen Anfängen in den 1950ern im darauffolgenden Jahrzehnt den Sprung zum Massenmedium, 1975 erreichte die Fernsehdichte in der Bundesrepublik 93 Prozent.
Dass Hörspielfans mittleren Alters heute dennoch die 1970er- und 80er-Jahre als ein goldenes Zeitalter des Genres in wohliger Erinnerung haben, hängt abermals mit dem Durchbruch einer technischen Innovation zusammen: der Audiokassette. Sie verhalf dem Genre damals vor allem bei Kindern und Jugendlichen zu großer Popularität. Bei dem Tonträger, auch Kompaktkassette oder Musikkassette genannt, befand sich ein Magnetband in einem Plastikgehäuse. Dieses war nur wenig größer als ein Handteller und damit viel praktischer als die bisherigen, eher klobigen Tonband-Spulen oder die 30,5 Zentimeter Durchmesser großen Langspiel-Schallplatten aus Vinyl, die in den 1950ern die alten Schellackplatten verdrängt hatten.