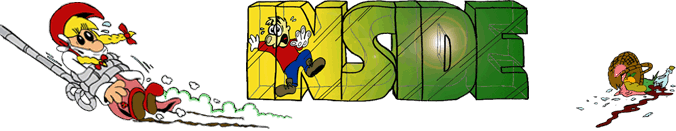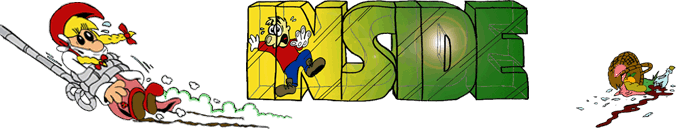- Offizieller Beitrag
„Alles Licht, das wir nicht sehen“: Die Blinde und der „gute Nazi“ – Review
Allzu oberflächliches Netflix-Kriegsdrama nach dem preisgekrönten Roman von Anthony Doerr
Rezension von Gian-Philip Andreas – 05.11.2023, 13:24 Uhr
Der Wehrmachtssoldat, dem die Frauen vertrauen: Louis Hofmann als Funkspezialist Werner Pfennig. – Bild: Netflix
Der vielleicht beste US-amerikanische Kriegsroman der letzten Jahre; aufwendig verfilmt von einem Streamingdienst, der unlängst für eine andere Kriegsromanverfilmung („Im Westen nichts Neues“) den Oscar abgeräumt hat; besetzt mit Stars wie Hugh Laurie und Mark Ruffalo; adaptiert von „Peaky Blinders“-Mann Steven Knight und inszeniert von „Stranger Things“-Regisseur Shawn Levy. Das klingt doch fantastisch! Kein Wunder, dass Netflix den Vierteiler „Alles Licht, das wir nicht sehen“ stolz als Prestigeproduktion bewirbt. Die Serie aber dürfte all jene ernüchtern, die sich davon mehr als ein oberflächliches Kriegsabenteuer erwarten – und erst recht jene, die Anthony Doerrs Buch schätzen: Von dessen erzählerischen Graubereichen ist in dieser auf leichte Konsumierbarkeit abzielenden Hochglanzproduktion wenig übriggeblieben.
Doerrs Roman, 2014 erschienen und mit dem Pulitzer-Preis dekoriert, erzählt nicht nur eine ziemlich unwahrscheinliche (und kurzzeitige) Liebesgeschichte zwischen einem 18-jährigen Wehrmachtssoldaten und einer 16-jährigen blinden Französin im Bombenhagel von Saint-Malo, kurz vor der Befreiung des von Nazis besetzten Frankreich durch die US-Amerikaner, er erzählt diese Geschichte auch sehr kunstvoll, abwechselnd aus zwei Perspektiven, nonlinear zurück- und vorausblendend. Zudem nutzt Doerr seinen historisch verorteten Plot, der aus sich selbst heraus schon ebenso spannend wie bewegend war, um Fragen des Sehens und Sehenkönnens zu umkreisen, auf buchstäblicher wie metaphorischer Ebene, es geht um (Radio-)Technik, um Kommunikation als Rettung, all dies in einer lyrischen Sprache, die das Fühlen, Hören, Sprechen kongenial erlebbar macht.
Solcherlei Dinge ins Filmische, ins Serielle gar, zu übersetzen, ist keine leichte Aufgabe, aber keine, von der man gedacht hätte, dass ein versierter Drehbuchautor wie Steven Knight sie dermaßen außer Acht lassen würde, wie er es jetzt getan hat. „Alles Licht, das wir nicht sehen“ konzentriert sich auf die Äußerlichkeiten des Plots und setzt fast ausschließlich auf die Oberflächenreize seiner Szenerie: Shawn Levys Inszenierung ist nach außen hin makellos, alles sieht schick aus, die Nazi-Flaggen wurden frisch gebügelt, die Trümmer in den kriegszerstörten (Studio-)Straßen sorgfältig verdreckt, die Flammen im Kriegsdunkeln lodern pittoresk und spiegeln sich in den traurigen Augen leidender Menschen, und der neunfach oscarnominierte Hollywood-Komponist James Newton Howard lässt dazu einen seiner patentiert elegischen Scores aufbranden.
Wärmende Stimme am Mikrofon: Die blinde Marie-Laure (Aria Mia Loberti) bringt Licht ins Dunkel des Weltkriegs. Netflix
Netflix hat also eigentlich alles, was es sich nur wünschen kann für ein Quality-Produkt zur Wintersaison: vier knapp einstündige Folgen, von denen die ersten drei mit einem bis zum Anschlag auf Lebensgefahr hochgedröhnten Cliffhanger enden und sofortiges Weiterschauen befehlen, dazu Weltkrieg, Romantik, Tragik. Womöglich geht das auf, denn unterhaltsam ist der Vierteiler durchaus. Nur fehlt ihm – und das unterscheidet ihn dann doch von vergleichbaren Netflix-Premium-Produktionen im historischen Setting wie etwa „Das Damengambit“ – jede tiefere Ebene. Das mag daran liegen, dass Knight und Levy so viele Elemente, Figuren, Hintergründe des Romans weggelassen haben (oder weglassen mussten), sich am Ende sogar sehr deutlich davon entfernen: Zurück bleiben Schablonen statt ausgearbeiteter Figuren, Klischees statt motivierter Handlungen und eine Serie, die weniger die Zeit des Zweiten Weltkriegs darstellt als eine aus vielen anderen Filmen und Serien abgekupferte Vorstellung von dieser Zeit. Alles wurde perfekt zurechtgemacht und wirkt doch wie Secondhand.
Zunächst immerhin halten sich die Macher noch an Doerrs Plot, der seine zwei Protagonisten wechselseitig vorstellt. Da ist zunächst Marie-Laure LeBlanc (in ihrer ersten Rolle: Aria Mia Loberti), eine blinde Jugendliche, die 1940, nach der Besetzung Frankreichs durch die Nazis und der Einsetzung des kollaborativen Vichy-Regimes, mit ihrem Vater Daniel („Avenger“ Mark Ruffalo als zarter, fast naiver Mann) ins Haus des Onkels Etienne (Hugh Laurie mit Zauselbart) geflüchtet war und jetzt, während sich die Alliierten nähern, alleine dort ausharrt und via Kurzwelle Nachrichten in die Welt hinaussendet: Ihr allabendlicher Vortrag aus Jules Vernes „20,000 Meilen unter dem Meer“ enthält verschlüsselte Botschaften an die Résistance. In Rückblenden geht es dann in ihre Kindheit in Paris. Daniel arbeitete da noch als Schlossermeister im Naturkundemuseum und die durch einen Unfall erblindete Marie-Laure suchte (und fand) neue Wege, sich trotzdem in der Welt zurechtzufinden. Nachts lauschte Marie-Laure schon damals immer dem „Professor“, der auf Kurzwelle (natur-)wissenschaftliche und humanistische Erkenntnisse über den Äther sendete: ein tägliches Licht in ihrer Dunkelheit.
Achtung, das personifizierte Böse stiefelt heran: Lars Eidinger als Reinhold von Rumpel in den Trümmern von Saint-Malo. Netflix
Dem „Professor“ (dessen Identität bald enttarnt wird) lauschte auch der zweite Protagonist: Wehrmachtssoldat Werner Pfennig, der auf das Enttarnen gefunkter Botschaften spezialisiert ist und Marie-Laure auf die Spur kommt. Louis Hofmann (seit „Dark“ international zugfähig) verkörpert ihn recht blass, als arisch-blondes Unschuldslamm, das selbstverständlich gegen seinen Willen in die Wehrmachtsuniform geraten ist. Das Klischee vom „guten Nazi“, der die genozidale Ideologie der Nationalsozialisten immer ablehnte, lebt hier ungut auf, und was im Roman noch differenziert behandelt wurde, bleibt hier banal. Werner, so zeigen es die Rückblenden, wurde aus dem Kinderheim heraus wegen seiner funktechnischen Expertise in eine „Napola“ wegrekrutiert, in eine dieser berüchtigten „Nationalpolitischen Erziehungsanstalten“ also, in der er den Ertüchtigungsterror der Nazis am eigenen Leibe erlebte. Mehr als kurze Schlaglichter darauf erlaubt die Serie nicht, und dass Werner die Kaderschmiede als Klassenbester verließ, wird nicht weiter hinterfragt. Im Anschluss ist er einfach der arglose Wehrmachtssoldat, der niemandem was Böses will – seine Verantwortung für zahlreiche Morde wird nur kurz angesprochen (Elizabeth Dulau aus „Andor“ in einem undankbaren Cameo als Résistance-Kämpferin).